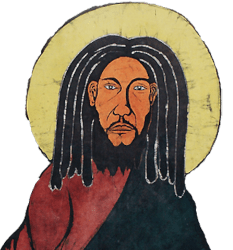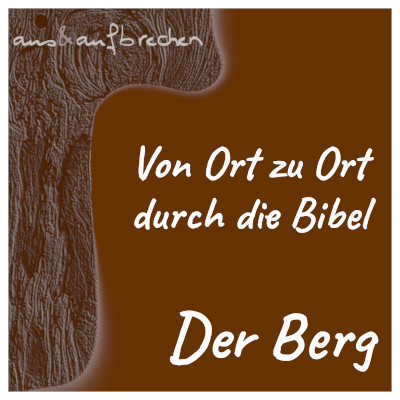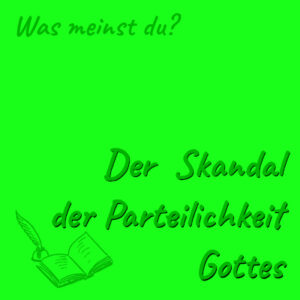Magst du Berge? Ich habe da eher ein zwiespältiges Verhältnis. In der Bibel ist der Berg aber von ganz zentraler Bedeutung. Er ist der Ort der Gottesbegegnung. Somit fällt auf, wenn er dort plötzlich nicht mehr zu finden ist.
In dieser Advent-Serie behandle ich Orte in der Bibel, die auch als Metapher für das Ende der Welt dienen. So gehen wir Schritt für Schritt aus dem Garten hinaus durch die Wüste auf einen Berg bis wir endgültig in der Stadt landen.
Diesen Podcast mache ich in meiner Freizeit. Wenn du diese Arbeit auch finanziell anerkennen möchtest, dann kannst du mich über ko-fi auf einen Tee einladen oder direkt über Paypal einen kleinen Betrag senden.
Transkript
Herzlich Willkommen zur 55. Episode.
Wir sind ja bisher vom Garten aus in die Wüste gegangen und klettern mit dieser Episode auf den Berg. Damit befinden wir uns mitten in einer adventlichen Serie über Orte der Bibel, die Metaphern für das Ende der Welt darstellen sollen.
Wer schon mal auf einen Berg hinaufgewandert ist, wird sicher die Erfahrung gemacht haben, wie anstrengend das ist. Das Bergabgehen ist dagegen oft viel leichter.
Es wundert also, dass Menschen sehr fröhlich und erleichtert wirken, wenn bei ihnen das Leben wieder bergauf geht. Dabei ist das real gesehen ja die anstrengendere Phase.
Aber gut, so verdrehen sich Metaphern oft im Leben. Jedenfalls scheint es eine positive Erfahrung zu sein, wenn es bergauf geht und man dann am Gipfel des Lebens angekommen ist.
Eine positive Metapher über das Leben, die vom Tal oder vom Fuß des Berges spricht, kenne ich hingegen nicht.
Wie dem auch sei. Heute geht es um den Berg.
Bevor es aber losgeht, möchte ich mich bei allen treuen Hörerinnen und Hörern bedanken. Vor allem auch für die positiven, aber auch kritischen Rückmeldungen, die ich bekomme. Es freut mich ebenso, wenn ihr meine Folgen mit eurem Netzwerk teilt, sodass sie auch andere hören können. Nachrichten von euch und Kommentare auf meiner Webseite lese ich immer gern. Ganz herzliches Danke an all jene, die mich über ko-fi oder PayPal finanziell unterstützen. Das hilft mir, meine Online-Angebote nicht durch lästige Werbung finanzieren zu müssen.
So jetzt geht’s aber los.
Ich bin ja kein großer Freund der Berge. Wenn ich das sage, ernte ich immer verwunderte Blicke – vor allem wenn die Leute wissen, dass ich aus Kärnten komme, wo wir von Bergen umzingelt sind. Anscheinend meinen viele, man müsse eine natürliche Affinität zu Bergen haben, wenn man in einer bergigen Gegend aufgewachsen ist. Das Gegenteil ist der Fall – zumindest bei mir.
Aber ich habe vor vielen Jahren eine Erkenntnis erlangt: Es gibt ja viele Menschen, die sehr euphorisch von Bergen schwärmen. Das konnte ich mir lange nicht erklären. Bis ich folgendes bemerkt habe:
Wenn ich von Bergen spreche, dann denke ich vom Tal aus. Ich sehe mich dann von Bergen umgeben, habe keinen Weitblick; der Horizont bleibt eingeschränkt. Es löst eine Enge aus, die Bewegungsunfreiheit bedeutet.
Jene aber, die von den Bergen schwärmen, denken nicht vom Tal aus, sondern vom Gipfel her. Sie haben gerade den Weitblick. Der Horizont ist weit weg. Sie sehen die Welt von oben. Das Unten wird ganz klein und man fühlt sich frei und dem Alltag enthoben.
Und so habe ich auch den Blick von oben und damit die Berge schätzen gelernt – von oben her, nicht von unten. Ich mag es aber auch in einer Gegend zu sein, die völlig flach ist. In Österreich erlebe ich das, wenn ich in der Gegend von Wien und dem Burgenland bin.
Aber am eindruckvollsten habe ich das in Ghana erlebt. Das erste Mal stieg ich aus dem Flugzeug und obwohl ich im Dunkeln nicht weit sehen konnte, spürte ich die große Weite dieses Landes. Ein Gefühl, dass ich mir bis heute nicht erklären kann.
Vielleicht geht es so auch vielen, von denen in der Bibel erzählt wird, dass sie auf einen Berg gestiegen sind. Wie ich schon gesagt habe, gibt es unzählige biblische Geschichten, in denen ein Berg eine wichtige Rolle spielt.
So landete Noah mit seiner Arche nach der Flut auf dem Berg Ararat. Und Abraham stieg auf den Berg Moria, um dort seinen Sohn Isaak zu opfern. Mose wurde auf dem Berg Horeb berufen, sein Volk aus der Sklaverei zu führen und auf dem Berg Sinai erhielt er die Zehn Gebote. Auch der Prophet Elia, von dem schon in der letzten Episode die Rede war, lieferte sich auf dem Berg Karmel mit den Propheten des Baal einen Opfer-Wettkampf.
Es zeigt sich ganz allgemein, dass Berge eine besondere Situation symbolisieren. D. h. wer aus dem Alltag, aus dem alltäglichen Tun aussteigen will oder muss, der hebt sich heraus aus diesem Alltag und geht auf einen Berg. Können wir das nicht nachvollziehen, dass die Situation am Berg uns vom Alltag abhebt? Wenn wir so nach unten schauen und alles ganz klein ist?
Wir sind der Erde entrückt und dem Himmel näher. Es ist also nicht weiter überraschend, wenn der Berg als ein Ort der Gottesbegegnung wahrgenommen wurde. Gottesbegegnung ist keine alltägliche Erfahrung, wie wir es heute oft behaupten. Gottesbegegnung geschieht zu speziellen Zeiten und an speziellen Orten. Der Berg ist dafür eine Metapher.
In diesem Sinne heißt es in Psalm 121:
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.
Psalm 121, Vers 1-2
In der Erzählung vom Empfang der Zehn Gebote am Berg Sinai in der Wüste wird das besonders deutlich: Nur Mose bestieg den Berg, wurde in eine Wolke gehüllt und verbrachte dort 40 Tage, in denen die Gebote abgefasst wurden.
Gleichzeitig sagt die Geschichte aber auch, dass um den Berg eine Grenze gezogen werden musste. Diese Grenze durfte niemand überschreiten, ansonsten müsse er sterben. Gottesbegegnung hat den Tod zur Folge; nur Mose darf Gott begegnen, um dem Volk seine Botschaft zu überbringen.
Mit anderen Worten: Die Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes ist so groß, dass kein Mensch vor ihr bestehen kann.
Die 40 Tage wurden dem Volk aber zu lang und sie bastelten sich einen neuen Gott, das goldene Kalb. Als Mose wieder herunterkam, wurde er so wütend, dass er die Steintafeln zerbrach. Er musste also nochmals auf den Berg und sich die Gebote abermals diktieren lassen.
Der Berg ist also im Alten Testament ein besonderer Ort, eine Ort der Gottesbegegnung und zugleich ein Ort, der aus dem Alltag heraushebt. Ein Ort der Erhebung.
So braucht man sich nicht mehr zu wundern, wenn Jesus auf einen Berg steigt, auf dem er verklärt wird. Er wird enthoben aus dem Alltag und abgehoben von den anderen Menschen, ja auch abgehoben von den größten Propheten des Volkes Israel, von Mose und Elia.
Verklärung meint: klar machen, etwas hell machen, Aufklärung, Erhellung. Jesus wurde strahlend weiß. Als Symbol des göttlichen Lichtes, das er am Berg empfangen hat.
Ähnliches hatte man sich auch schon von Mose erzählt. Sein Gesicht hat gestrahlt, als er vom Berg Sinai wieder heruntergestiegen war.
Ich hoffe, es wird deutlich, dass diese Geschichten zwar ein mythologisches Gewand haben, dass sie aber etwas Bedeutendes über die handelnden Personen, aber auch über das Leben und die Beziehung zu Gott aussagen möchten.
Wer auf den Berg darf, wer Gott begegnen darf, sind besondere Menschen, Menschen, die herausgehoben werden. Sie müssen auch speziell herausgehoben werden, weil die Begegnung mit Gott tödlich enden kann. Gott hat aber kein Interesse am Tod der Menschen. Deshalb grenzt er sich ab und wählt besondere Menschen aus, die in seinem Angesicht bestehen können. Nicht weil sie besonders untadelig wären. Mose war ja ein Mörder. Sondern sie können bestehen, weil Gott es so will.
Sicher: Gott könnte ja bei allen Menschen wollen, dass sie ihm gegenüber bestehen. Das kann man so annehmen. Aber diese Erzählungen wollen nicht sagen, was Gott tun könnte, sondern wie die Autoren die Beziehung zu Gott wahrgenommen haben. Und sie nehmen sie sehr ambivalent wahr: Einerseits erkennen sie Gottes Handeln und seine Richtlinien, andererseits merken sie seine Erhabenheit und Heiligkeit, der sich kein Mensch nähern kann. Es geht hier nicht um logische Systematik, sondern um den Versuch, eine ambivalente Erfahrung in mythologischer Sprechweise wiederzugeben.
Mit Jesus scheint sich hier aber etwas zu verändern. Nach dem Matthäus-Evangelium steigt er auf einen Berg und spricht über die Gesetze und Regeln Gottes. Lassen wir mal die Frage beiseite, ob das neue oder schon lange bestehende Regeln sind oder die alten Regeln bloß neu interpretiert werden. Auffallend sind noch ganz andere Dinge:
Jesus empfängt nicht die Regeln von Gott wie Mose, sondern er ist die Autorität, die die Gesetze authentisch geben kann.
Die Jünger stehen um den sitzenden Jesus herum. Er lehrt sie, wie es damals unter den Rabbis, den jüdischen Gelehrten, üblich war. Das bedeutet aber auch, dass um den Berg keine Grenze gezogen wurde, die niemand überschreiten darf. Die Jünger dürfen ebenfalls am Berg sein.
Aber nicht nur die Jünger, sondern das ganze Volk. Jesus lehrt zwar am Berg nur seine Jünger, aber das Volk ist als Zaungast dabei. Die Grenze ist aufgehoben.
Alles zusammen genommen zeigt sich, dass der Berg nicht nur der Ort der Gottesbegegnung ist, sondern auch der Ort, an dem Gott beruft, an dem Gott sein Macht erweist und / oder an dem Gott seine Gesetze erlässt.
Umso auffälliger ist es dann auch, wenn Jesus vor seiner Verhaftung am Ölberg verzweifelt und voll Angst betet. Und keine Gottesbegegnung mehr hat. Die Gottverlassenheit, die Jesus am Kreuz hinausschreit, beginnt auf einem Berg, der eigentlich der Ort der Gottesbegegnung sein soll. Jesus will sich in der Stunde der Not in die Hände Gottes flüchten. Doch da ist kein Gott mehr, der ihm zur Seite steht. Ab jetzt steht er allein da.
Und wie im Alten Testament die Begegnung mit der Heiligkeit Gottes tödlich sein kann, so ist jetzt umgekehrt der Gang in den Tod der Weg in die Gottverlassenheit.
Wir befinden uns gerade in der Adventzeit und wie ich schon in den letzten Episoden gesagt habe, ist das die Zeit des Wartens auf eine neue Welt. So besteht auch hier die Frage: Spielt der Berg als Metapher eine wichtige Rolle in der Beschreibung dieser zukünftigen Welt?
Schon im Alten Testament gibt es die Vorstellung, dass am Ende der Zeit alle Völker zum Berg des Herrn ziehen werden. Bei den Propheten Jesaja und Micha (Jes 2,2-3; Mich 4,1-2) ziehen die Nationen zum Berg Zion. Von dort werden alle die Weisung Gottes erhalten und danach leben können. Dieser Berg des Endes wird also als Berg der Gesetzgebung verstanden, als endgültiger Empfang der Weisung Gottes, wonach sich dann auch alle Menschen ausrichten. Es wird eine Zeit des Friedens und der Gerechtigkeit sein, weil niemand mehr die Weisung Gottes missachten wird.
In der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, gibt es einmal eine Vision von einem Berg, auf dem das Lamm mit seinen 144.000 Geretteten steht (Off 14,1-5). Diese Zahl ist symbolisch gemeint. Sie entsteht durch 12 mal 12 mal 1000. Sie enthält also die 12 Stämme Israels und die 12 Apostel. Auf ihnen ruht unser Glaube. Und die 1000 ist die typische Ausdrucksweise im Hebräischen, wenn man „sehr viel“ sagen möchte. Also stehen auf dem Berg mit dem Lamm sehr viele, deren Glaube auf den zwölf Stämmen Israels und den zwölf Apostel ruht.
Sie singen ein Lied und tanzen, denn sie sind freigekauft worden. Und die Geretteten folgen dem Lamm nach.
Hier stehen nicht mehr Gottes Weisungen im Vordergrund, sondern die Freude über die Erlösung. Im Lamm, das geschlachtet wurde, also in Jesus, begegnet man Gott und feiert seine Erlösung von den bösen Mächten dieser Welt.
Hier werden wirkmächtige Bilder einer zukünftigen Welt entworfen. Sie dürfen nicht wortwörtlich verstanden werden, sondern als Metaphern, die über eine Zeit sprechen, von der noch keiner weiß, wie sie genau aussehen wird. Daher verwendet man Bilder, die mit Bedeutungen verbunden sind, die sich aus der Erzählung vergangener Ereignisse speisen. Deshalb ist wichtig, immer die Verbindungslinie zwischen den Bergen Ararat, Moria, Horeb, Sinai, Karmel, den Berg der Predigt, dem Ölberg und dem Berg Zion zu sehen. Diese Bilder enthalten noch viel mehr, als ich in einem Podcast sagen kann.
Im Gegensatz zur Wüste, die nur eine Zwischenstation darstellt, wird der Berg als endgültiger Wohnort der Völker, der Menschen vorgestellt. Der Berg, der heraushebt, der die Menschen von der Erde weghebt und ihnen eine neue Lebensweise ermöglicht, eine Lebensweise im Zusammenleben mit Gott.
Am Ende der Offenbarung entwirft der Visionär Johannes noch ein anderes Bild, nämlich das einer Stadt, die unsere endgültige Wohnstätte sein soll. Steht diese Stadt auf einem Berg? Das ist unklar. Es heißt in der Offenbarung nur, dass der Geist Johannes auf einen Berg stellt, um ihm diese Stadt zu zeigen. Ob diese Stadt auf dem Berg ist oder ob Johannes von oben hinunterschaut ist nicht klar.
Auch beim Evangelisten Matthäus finden wir den Satz:
Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben.
Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 14
Der Berg und die Stadt sind also in der Vorstellung vom Ende der Zeit zwei wichtige Orte, die miteinander verbunden sind. Aber dazu mehr in der nächsten Episode, in der wir am Ende endlich in der Stadt angekommen sind.