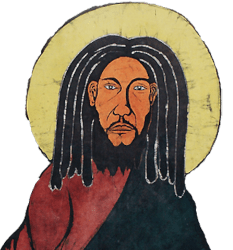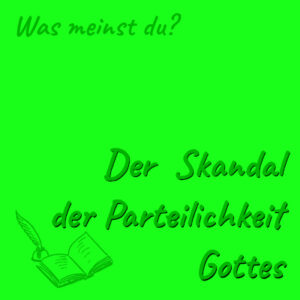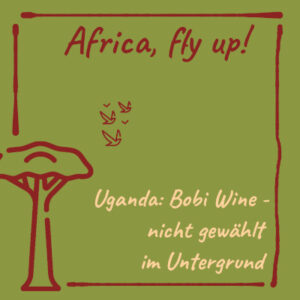Simone Weil ist eine bemerkenswerte Mystikerin des 20. Jahrhunderts. Die gebürtige Jüdin wendete sich dem Christentum zu, hatte aber eine universelle Mystik vor Augen. In dieser Episode zeigt sich das an den Themen der Befreiung und Begehren, zielt sie als „linke“ Denkerin doch auf ein ich-loses und etwas-loses Begehren ab, dass frei ist vom Haben-Wollen des Besitzes.
Ich zitiere aus dem Buch: Weil Simone, Schwerkraft und Gnade. Aus dem Französischem von Friedrich Kemp. Neu herausgegeben von Charlotte Bohn und mit einem Essay von Franz Witzel, Berlin 2021.
Hier der erwähnte Podcast zu Eckeharts ähnlichen Gedanken:
Transkript
Herzlich Willkommen zur 60. Episode.
Ich weiß, dass mein Podcast ein großes Manko hat: Es kommen zu wenige Frauen vor. Ich bemühe mich, das ein wenig auszugleichen. Es gelingt mir nur nicht so, wie ich es gern hätte.
Aber diesmal möchte ich auf eine Frau, nämlich Simone Weil zu sprechen kommen. Genauer gesagt: Auf ein Thema in ihrem bekanntesten Buch „Schwerkraft und Gnade“.
Simone Weil wurde 1909 in Paris geboren. Sie war Tochter säkularer, wohlhabender Juden. Ihr Studium der Philosophie schloss sie 1931 ab und wurde anschließend Lehrerin. Sie beschäftigte sich früh mit dem Arbeitsrecht und der sozialen Frage. Mit dem Marxismus verband sie die Kritik an der Ungleichheit der Menschen und der Ausbeutung durch Kapitalismus. Für einige Monate arbeitete sie auch als Fabriksarbeiterin, um am eigenen Leibe zu spüren, welche Auswirkungen eine solche Arbeit hat.
Im Laufe der nächsten Jahre machte sie drei mystische Erfahrungen, die ihr Leben nachhaltig prägen sollten. Sie konvertierte nicht formell zum Christentum, obwohl sie eine tiefgreifende spirituelle Verbindung zum christlichen Glauben katholischer Prägung entwickelte. Diese Erfahrung führte sie zu einer tiefen Auseinandersetzung mit christlicher Theologie, insbesondere mit den Schriften der Mystiker und der Bibel.
Ihr schwebte eine universelle Mystik vor: Sie suchte eine Wahrheit, die alle Menschen, unabhängig von Religion, einschließt. Sie sah in allen großen religiösen Traditionen einen gemeinsamen Kern der göttlichen Weisheit.
Im Zweiten Weltkrieg floh sie vor den Nazis über die USA nach England. 1943 wurde bei Weil Tuberkulose diagnostiziert, an der sie im selben Jahr im Alter von 34 Jahren starb. Darüber, ob sie sich vor ihrem Tod noch taufen ließ, gibt es widersprechende Berichte.
Das war nur ein kleiner Abriss ihres Lebens. Obwohl es kurz war, bietet es viele spannende Begebenheiten, die es wert wären, näher zu beleuchten.
Ich möchte mich aber einer Passage aus ihrem Buch „Schwerkraft und Gnade“ widmen, einem spirituellen Buch, geschrieben in Aphorismen bzw. kleinen Absätzen. Mir geht es dabei nicht so sehr darum, die Ansichten Weils einer kritischen Prüfung zu unterziehen, sondern einfach ihre Gedanken nachzuvollziehen. Denn ich hätte am Ende doch die eine oder andere kritische Rückfrage. Aber diese überlasse ich diesmal euch.
Wenn ihr übrigens wissen wollt, wo die zitierten Passagen stehen, dann schaut auf meine Webseite zu dieser Episode. Dort findet ihr die genauen Stellenangaben.
Ich freue mich auch, wenn ihr bei dieser Gelegenheit dort auch einen Kommentar hinterlässt.
Vielen Dank an alle treuen Hörerinnen und Hörern für die Nachrichten und auch für die finanzielle Unterstützung über ko-fi und PayPal. Das erspart uns allen lästige Werbung.
So! Und jetzt geht’s los.
Ich lese zuerst eine Passage vor, gebe aber zugleich auch schon eine Warnung aus. Simone Weil schreibt oft nicht in ganzen Sätzen. Sehr häufig taucht das Zeitwort nur in seiner Nennform auf, also im Inifinitiv. Das gibt den Texten einen eigenen Klang, den einzelnen Sätzen einen Nachklang im Geist der Leser:innen.
Hier also die etwas längere Passage:
Man setzt Energie frei. Aber sie gerät unaufhörlich in neue Verhaftung. Wie gelangt man dahin, sie gänzlich zu befreien? Man muss begehren, dass dies in uns geschehe. Dies wirklich begehren. Es bloß begehren, nicht versuchen, es zu vollbringen. Denn jeder Versuch in dieser Richtung ist eitel und wird teuer bezahlt. Bei einem solchen Werk muss alles, was ich ‚ich‘ nenne, sich passiv verhalten. Von mir wird nichts gefordert als die Aufmerksamkeit, eine so völlige Aufmerksamkeit, dass ‚ich‘ verschwindet. Allem, was ich ‚ich‘ nenne, das Licht der Aufmerksamkeit entziehen und es auf das Unvorstellbare richten.
Weil, Schwerkraft und Gnade, 129
Solche Absätze sind oft schwer verständlich und auch wenn man sich mit ihnen beschäftigt, bleibt immer ein Teil unverständlich. Der Grund liegt darin, dass man eine Passage auch in Verbindung mit anderen lesen muss. Dann ergibt sich ein Bild, welches aber nicht immer völlig widerspruchsfrei sein muss.
Nun, ich möchte mit dem ersten Satz beginnen: Sie spricht von Energie. „Man setzt Energie frei.“ Hier stellen sich schon viele Fragen: Wer ist dieses „Man“? Was meint sie mit „Energie“? Was bedeutet „freisetzen“?
Lesen wir es als Bild: Mir fällt da ein Luftballon ein, der zerplatzt. Energie wird frei gesetzt. Es ertönt ein Schall. Die Gummifetzen fliegen herum. Die Luft im Ballon verweht als kleiner Wind.
Aber, so schreibt sie weiter: Diese Energie bleibt nicht unendlich frei: Der Schall verklingt, die Fetzen fliegen zu Boden, der Wind vergeht. Weil sagt, die Energie gerät in neue Verhaftung. Das Wort „Verhaftung“ ist ein wichtiges Wort für Weil.
Wer nach anderen Stellen zu diesem Wort sucht, wird schnell merken, dass wir das Bild der physikalischen Energie verlassen und in ein ganz anderes Feld eintauchen.
Das Wort „Verhaftung“ hat eine doppelte Bedeutung: Gemeint ist das Anhaften an etwas und zugleich der Aufenthalt in einem Gefängnis. Spätestens jetzt komme ich mit meinem Luftballon-Beispiel nicht mehr weiter.
Ich muss umschwenken und lese einfach einmal andere Stellen.
Im restlichen Absatz spricht sie vom Ich und von der Aufmerksamkeit. Es scheint also um dieses Ich zu gehen. Geht es also um die Verhaftung des Ich?
Ja. Sie spricht in diesem Zusammenhang oft von einem Strick oder Faden, der uns mit der Welt oder den Dingen in der Welt verbindet. Solange auch nur ein Faden zu diesen Dingen besteht, bleiben wir verhaftet. Das Ich, das Energie ist, wird stillgestellt, d. h. unfrei. Freiheit erlangen wir nur, wo die Energie in Bewegung bleibt; dann haben wir auch Zugang zur Wirklichkeit.
Verhaftung an den Dingen erzeugt Täuschung. Wenn ich mich aber von den Dingen ablöse, dann werde ich frei für die Wirklichkeit (21). Das heißt, für Weil kommen wir erst in Kontakt zur Wirklichkeit, wenn wir frei sind und den Dingen nicht mehr anhaften.
Dasselbe gilt für unsere Werte: Wir lassen die falschen Werte gelten und haften uns an sie an. Wir erkennen dabei nicht, wie unbeweglich wir werden und dass wir damit nicht in Kontakt mit der Wirklichkeit komme. (59)
Diese Verhaftung ist also nicht nur ein Anhaften, sondern zugleich auch ein Gefängnis. Sie schreibt:
Allem, dem man anhaftet, ist man durch einen Strick verhaftet, und jeder Strick kann durchschnitten werden.
Weil, Schwerkraft und Gnade, 73
oder eine andere Passage:
Das Unglück, das uns zwingt, uns an erbärmliche Dinge zu heften, legt den erbärmlichen Charakter der Verhaftung bloß. Hieraus erhellt noch deutlicher die Notwendigkeit der Ablösung.
Weil, Schwerkraft und Gnade, 21
Ich denke, es ist klar, worauf sie hinauswill: Das Ich kann befreit werden. Es ist Energie, die frei werden kann. Und jetzt ist klar, was sie meint, wenn sie schreibt, dass diese befreite Energie sich wieder verhaftet. Sie beschreibt damit die Eigenart des Menschen, seine Freiheit nicht frei sein zu lassen, sondern sich sogleich wieder an das nächste Ding, andere Werte und Überzeugungen zu verhaften und neuerlich in ein Gefängnis einzuziehen.
Sie spricht vom horror vacui (128): Gemeint ist die Angst vor der Leere. Wie es in der physikalischen Welt kein Vacuum, keine Leere, geben darf, so will auch unser Geist keine Leere. Er möchte sie immer mit neuen Dingen füllen, an die er sich verhaften kann.
Und deshalb fragt sie: „Wie gelangt man dahin, sich gänzlich zu befreien?“
Ihre Antwort ist das Begehren dieser gänzlich befreiten Freiheit. Das heißt, sie will beim Begehren stehen bleiben und nicht versuchen, das Begehrte zu erhalten. Das würde ja wieder nur eine neue Verhaftung bedeuten. Bleibe ich aber passiv im Begehren stehen, dann bleibe ich auch gänzlich frei.
An dieser Stelle zeigt sich aus ihrer Sicht eine Verbindung von verschiedenen religiösen Traditionen. Sie schreibt:
Die Auslöschung der Begierde (Buddhimus) – oder die Ablösung – oder der amor fati – oder das Verlangen nach dem absoluten Guten –, immer handelt es sich um das Gleiche: Entleerung der Begierde, des Zielstrebens von jedem Inhalt, entleertes, wunschloses Verlangen.
Weil, Schwerkraft und Gnade, 19
Mit dem Wort „Ablösung“ ist der Gegenbegriff zur „Verhaftung“ bei Simone Weil benannt. Ablösung ist damit das freisetzen der Energie.
Die Ablösung bleibt unverhaftet, wenn wir bei der bloßen Begierde stehen bleiben; bei der Begierde, die nicht erfüllt wird. Wir sollen uns passiv verhalten, nicht aktiv das Begehrte suchen.
Und hier komme ich ins Überlegen, wie Weil das genau meint: Gibt es ein Begehren ohne etwas zu begehren? Ist nicht jedes Begehren auf ein Etwas gerichtet?
Sicher: Man kann sich das jetzt so denken, dass wir zwar immer etwas begehren, aber wenn wir passiv bleiben und das Etwas nicht aktiv zu gewinnen versuchen, dann bleiben wir frei.
Aber Weil geht noch einen Schritt weiter: Sie sagt, dass wir dieses Begehren entleeren sollen. Das bedeutet, jedes Etwas aus unserem Begehren zu streichen und nur das Begehren als solches übrig zu lassen. Das entleerte Begehren begehrt nicht mehr Etwas, sondern begehrt einfach nur mehr.
Deshalb schreibt sie auch:
Welcher Mensch sein Heil begehrt, der glaubt nicht wahrhaft an die Wirklichkeit der Freude in Gott.
Weil, Schwerkraft und Gnade, 44
Also auch das Heil als ein Etwas soll nicht begehrt werden.
Ich wiederhole kurz: Wer in den Dingen die Wirklichkeit sieht, der täuscht sich. Er ist den Dingen verhaftet und nicht frei. Erst die Freiheit bringt den Menschen zur Wirklichkeit. Zur Ablösung von der Täuschung. Die Ablösung kann aber nur geschehen, wenn man beim passiven Begehren stehen bleibt, ohne etwas Konkretes zu Begehren. Das hält die Energie frei.
Nun sagt sie aber auch, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf das Unvorstellbare richten sollen. Damit richten wir es ja wieder auf ein Etwas. Jedoch ist dieses Etwas etwas Seltsames. Das Unvorstellbare ist ein Grenzbegriff: Es ist zugleich ein Etwas, auf das wir unsere Aufmerksamkeit richten. Zugleich ist es kein bestimmtes Etwas, weil es all unsere Vorstellungen übersteigt und damit auch seine Etwas-heit, also seine Eingegrenztheit, verliert.
Ich glaube auch, dass Weil dieses Unvorstellbare meint, wenn sie von „Wirklichkeit“ spricht. Wirklichkeit meint nicht die bloße Existenz von Dingen, sondern jenes Sein, das uns frei sein lässt, wenn wir die Aufmerksamkeit auf es richten.
Diese Aufmerksamkeit auf das Unvorstellbare nennt Simone Weil Gebet (127).
Es gibt jetzt aber noch eine zweite Seite: Das Begehren richtet sich nicht nur auf Etwas, sondern ist immer Begehren von jemanden, also von einem Ich.
Ihre Aussagen dazu sind mehrdeutig: Will sie sagen, das Ich muss verschwinden? Oder will sie sagen, dass wir nur die Aufermerksamkeit vom Ich abziehen sollen? Oder meint sie gar, dass der Entzug der Aufmerksamkeit auf das Ich zugleich das Ich zum Verschwinden bringt?
Hier finden wir keine Aufklärung bei Weil: Wir können nur fragen: Wenn das Ich verschwindet, wer begehrt dann noch? Ist ein solches ich-loses Begehren überhaupt möglich? Es gibt einige Passagen in ihrem Buch, die genau darauf hinauswollen: nämlich das Ich zum Verschwinden zu bringen.
So meint sie, dass wir genausoviel Fülle dabei erfahren sollen, dass wir nicht sind, als über die Freude Gottes (44). Und sie schreibt:
Zwei Arten sich zu töten: Selbstmord und Ablösung.
Weil, Schwerkraft und Gnade, 22
Ablösung ist also nicht nur Enthaftung, sondern auch das Verschwinden des Ich.
Mit dieser Sicht auf Passivität und Ichlosigkeit befindet sie sich in guter Gesellschaft mit der klassischen, christlichen Mystik, aber auch mit anderen Religionen wie dem Buddhismus. Ich gebe dazu einen Link einer alten Podcast-Folge zu Eckehart in die Shownotes.
Wir können diese Gedanken aber auch etwas abmildern. Dann geht es nicht mehr um das Verschwinden des Ich, sondern um den Entzug der Aufmerksamkeit dem Ich gegenüber. Und eben das Richten der Aufmerksamkeit dem Unvorstellbaren entgegen.
Simone Weil – so verstehe ich sie – legt mit diesen Gedanken die mystische Seite eines sozialpolitischen Aktivismus vor: Die Ungleichheit in den Besitzverhältnissen und die daraus resultierende Unfreiheit vieler Menschen ist nicht dadurch zu lösen, dass der Besitz umverteilt wird. Das Verhaftetsein am Besitz ist selbst schon die Unfreiheit. Besitz umzuverteilen würde nur Unfreiheit umverteilen.
Dagegen setzt Weil die Befreiung von einem solchen Denken. Das muss nicht in Besitzlosigkeit enden. Es genügt das Begehren nach dem Unvorstellbaren aufrecht zu erhalten, in dem die Aufmerksamkeit völlig vom Ich und das Begehren völlig vom Etwas abgezogen wird.