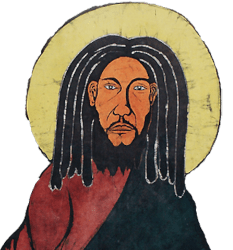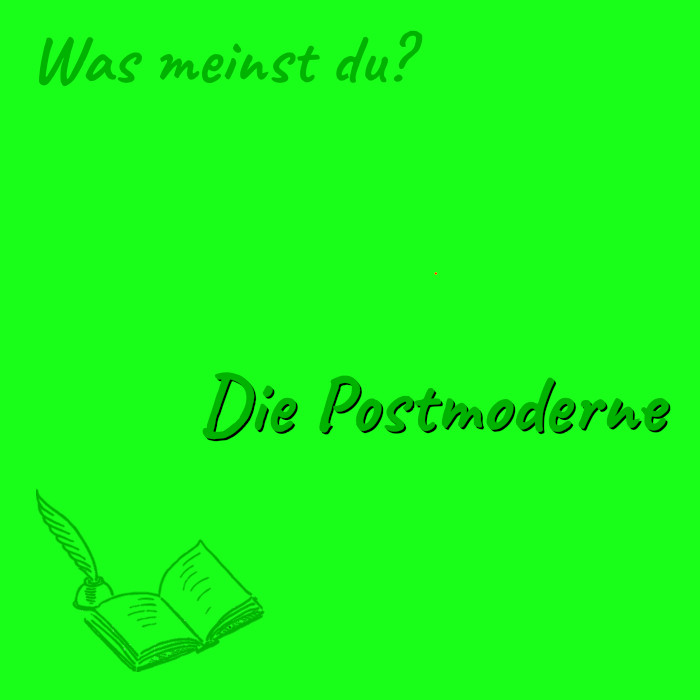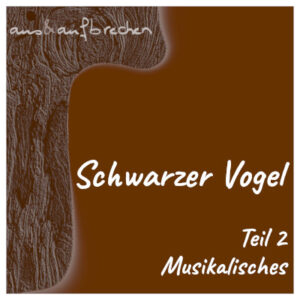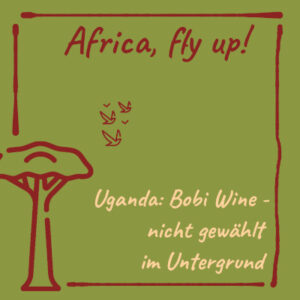In den letzten zwei Wochen habe ich ein Skriptum zum Thema „Sozialphilosophie und Soziologie“ geschrieben. Hier ein Ausschnitt über das Thema Postmoderne.
(Text wurde nicht Korretur gelesen, kann also Fehler enthalten.)
Euer Feedback freut mich?
Was lest ihr heraus?
Die Postmoderne
Kein Wunder also, wenn man Mitten des 20. Jahrhundert mit all dem brechen wollte. Auf den alten Prinzipien der Moderne war kein Zusammenleben mehr möglich. Man trat ein in die Epoche der Postmoderne, in der wir immer noch leben. So zumindest deutete man den Umbruch dieser Zeit. Denn hier stellen sich zwei kritische Fragen:
Kann man so früh, also nur wenige Jahrzehnte nach 1950 wirklich schon beurteilen? Der Ausdruck stammt vom Buch „Das postmoderne Wissen“ (La Condition Postmoderne) von Jean-François Lyotard aus dem Jahr 1979. Man sollte kritisch sein, ob man schon so früh einen Epochenumbruch feststellen kann.
Zudem stellt sich die Frage, wie sich eine Zeit versteht, die sich als Postmoderne versteht. Dieser Ausdruck heißt einfach nur „nach der Moderne“. Der Ausdruck „Postmoderne“ sagt also überhaupt nichts (inhaltliches) über diese Epoche aus, außer dass sie zeitlich nach der Moderne kommt.
Mit gutem Grund können wir also auch einfach annehmen, dass wir weiterhin in der Moderne leben. Da aber keine Epoche statisch ist, so entwickelt sich einfach auch die Moderne weiter, besonders nach zwei Weltkriegen.
Denn wir sehen an unserer Zeit eines: Eigeninteresse, Nationalismus, der selbstbestimmte Mensch, von dem aus die Welt gesehen wird und der sich der Welt weiterhin bemächtigt sind nach wie vor leitende Prinzipien unserer Zeit.
Die 68-Generation stellte hingegen stellte die klassischen Formen von Autorität in Frage, die Wirtschaft entwickelte sich zu einer postindustriellen, in der Dienstleistung, Tourismus und seit den 1990er digitale Produkte immer wichtiger wurden, und auf allen Ebenen setzte sich eine Fragmentierung des Lebens durch, das nicht mehr einheitlich, sondern spannungsreich und widersprüchlich gedeutet wird.
Den Wandel der Mentalität nach dem Zweiten Weltkrieg kann folgendermaßen zusammengefasst werden:
Der Glaube an „große Erzählungen“ ist verschwunden. Darunter werden Erklärungen (in Form von Geschichten) verstanden, die einen umfassenden Zusammenhang der Entwicklung der Menschheit bzw. der Gesellschaft darstellen. Religionen bieten z. B. solche Erzählungen, wenn sie ein in sich geschlossenes Bild der Welt von der Schöpfung bis hin zum Endgericht vorstellen. Aber auch der Marxismus bietet mit seiner Idee von Klassenkämpfen und einer klassenlosen Gesellschaft eine solche Erzählung oder die Aufklärung in ihrem Glauben an den Fortschritt der Wissenschaften.
Heute glaubt niemand mehr diesen Erzählungen. Vielmehr erzählt man sich kleine Erzählungen, die brüchig und auch widersprüchlich sein können. Aber für mehr sieht man sich nicht in der Lage. Beispiele für kleine Erzählungen sind die eigene Biographie oder die Familiengeschichte, aber auch kulturelle oder regionale Geschichten. Sie erheben nicht mehr den Anspruch, alles erklären und deuten zu können, sondern wollen einfach nur Einblick in eine mögliche Entwicklung bieten.
In diesem Kontext entstand auch die Rede vom Narrativ. Das Narrativ kann zwei Bedeutungen annehmen, ist aber immer von der bloßen Erzählung zu unterscheiden:
Narrativ kann die bloß formale Struktur einer Erzählung meinen. Die bekannteste Struktur ist die zwölfstufige Heldenreise. Konkrete Erzählungen wären dann „Herr der Ringe“, „Star Wars“, „Harry Potter“ usw. Andere formale Strukturen wären z. B: die Tragödie, die kein Happy End kennt, die Reiseerzählung oder fragmentarische Erzählungen.
Ein andere Auffassung versteht das Narrativ als fundamentale Erzählungen einer Kultur. Es geht also nicht um irgendwelche Erzählungen, sondern um solche, die einer Gemeinschaft, Gesellschaft oder Kultur Identität verleiht. Dazu gehören z. B. Gründungsmythen oder Erzählungen, die immer wieder in verschiedenen Kontexten auftauchen. Z. B.: Amerika, in dem der Tellerwäscher Millionär werden kann. Solche Narrative können aber auch fremdzugeschriebene Identitäten sein. Z. B.: Alle Menschen in Afrika leiden unter Hunger und Armut.
Die Rede von den Narrativen verbindet sich leicht mit dem Sozialen Konstruktivismus, indem gesagt wird, dass wir unsere Identität überhaupt nicht aus dem speisen, was wirklich ist, sondern lediglich in diesen Narrativen konstruiert wird.
Mit dem Aufkommen der kleinen Erzählungen wird auch der Pluralismus verstärkt. Je individueller sich eine Gesellschaft sieht, je mehr Selbstbestimmung zum höchsten Wert wird, desto größer muss auch die Toleranz gegenüber anderen Menschen und Lebensformen werden. Allgemeingültige Regeln, Normen und Lebensformen scheint es nicht mehr zu geben oder können nur schwer plausibel gemacht werden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Macht zu einem zentralen Thema philosophischer, politischer und gesellschaftlicher Diskurse. Viele Denker:innen und philosophische Strömungen setzen sich mit der Macht auseinander: Michel Foucault, die Frankfurter Schule mit Max Horkheimer und Theodor W. Adorno sowie postkoloniale und feministische Philosophien.
Macht dabei zunehmen kritisch gesehen. Macht verteilt sich nicht mehr nur auf Institutionen, sondern ist ein Element in all unserer menschlichen Kommunikation. Deutlich ist: „Wissen ist Macht.“ Foucault betont, dass Wissen nicht nur zur Beschreibung der Realität dient, sondern auch aktiv zur Ausübung von Macht eingesetzt wird. Diskurse schaffen und definieren, was als wahr oder akzeptabel gilt, und beeinflussen somit das Verhalten und die Wahrnehmung der Menschen.
Damit verbindet sich nun auch die Skepsis gegenüber der Vernunft und dem Wissen und damit gegenüber der Wissenschaft. Nicht erst die Corona-Pandemie hat die Wissenschaftsskepsis hervorgebracht, sondern lediglich sichtbar gemacht.
Thomas S. Kuhn meint in seinem Buch „Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen“, dass die Theorieentwicklung in den Wissenschaft nicht logischen Argumenten und entlang neuer Erkenntnisse folgt. Vielmehr setzen sich neue Theorien dadurch durch, dass die Vertreter:innen der alten Theorie aussterben. Paul Feyerabend zieht im Anschluss an Kuhn und Popper den Schluss, dass in der Wissenschaft methodisch alles möglich sei (anything goes), Hauptsache, man hat eine brauchbare Theorie. Die Wahrheit ist dabei nicht entscheidend.
In Folge der Wissenschaftsskepsis erhöht sich der Kurs anderer Zugangsmöglichkeiten zur Welt: Die so genannte Esoterik als bewusst unwissenschaftliche Denkweise gewinnt zunehmend mehr Anhänger. Verschiedene religiöse und spirituelle Praktiken werden rezipiert, aber nicht mehr als große Erzählungen, sondern als kleine Elemente und Fragmente, deren Bedeutung nicht vom Ursprungskontext übernommen wird, sondern in das Verständnis unserer Kultur eingebettet werden. Beispiele dafür sind Yoga, Tai Chi, Qi gong, Zen-Meditation oder auch Achtsamkeitstrainings.
Der Rationalität wird das Gefühl gegenüber gestellt. Sieht man die Vernunft kritisch, werden die Gefühle wichtiger. Der Mensch wird nicht mehr als vernünftiges, vernunftsbegabtes Wesen gesehen, sondern im Kern als fühlendes. Das Gefühl ist das Unterscheidungsmerkmal zu den Maschinen, die bald intelligenter zu sein scheinen als der Mensch. Durch das Gefühl sehen wir uns aber verbunden mit den Tieren. Es ist daher kein Problem mehr, den Menschen als (ein besonderes) Tier zu sehen und den Tieren mehr Rechte einzuräumen.
In unserem Lifestyle ist es wichtig uns wohlzufühlen und auch anderen gute Gefühle zu verschaffen. Oder zumindest das gute Gefühl anderer nicht zu verhindern. Ganz böse ist es, andere zu kränken. Daher braucht es eine gendergerechte Sprache und Bücher müssen von Sensitivity-Readern auf unbewusst klassistische, rassistische oder andere Formulierungen durchgelesen werden, die andere verletzen könnten. Zunehmend wird auch die Frage nach der Verletzung religiöser Gefühle wichtig.
Auch Identitäten werden über das Gefühl definiert: Man gilt als Mann, fühlt sich aber als Frau. Das Gefühl spricht die Realität aus, nicht das, was auf einer Geburtsurkunde steht. Man fühlt sich zu jenem Geschlecht hingezogen. Das Gefühl bestimmt die sexuelle Orientierung, die wir auch als Identitätsmerkmal verstehen. Wir fühlen uns dieser oder jene Gruppe, Religion oder Weltanschauung zugehörig, also sind wir es auch. Kurzum: Wirklichkeit eröffnet sich in Gefühl, nicht im vernünftiges Erkennen.
Dies sollen nur einige Punkte sein, wie man heute die Postmoderne charakterisiert. Gleichzeitig zeigt sich in unserer Zeit aber auch immer das Gegenteil. Hier sollen kurz einige Punkte benannt werden:
Während man immer noch auf das autonome Subjekt, auf die Selbstbestimmung des Einzelnen setzt, meint man auf der anderen Seite, dass die Welt und der Mensch lediglich Produkt sozialer Konstruktionen ist.
In Bezug auf die kleinen Erzählungen: Ist nicht auch die Ansicht, es gäbe nur kleine Erzählungen, selbst eine große Erzählung? Aber abgesehen davon: Erleben wir nicht auch, wie sehr sich Menschen nach großen Erzählungen sehnen. Manche Spiritualitätsformen wirken wie der Versuch, dem Menschen und seinem Leben wieder Sinn zu verleihen. Auch die sehr konservativ ausgerichteten, religiösen Gruppierungen können vielleicht als Hort großer Erzählungen verstanden werden. Ebenso sind Verschwörungstheorien große Erzählungen. Aber auch auf politischer Ebene finden sich zunehmend große Erzählungen wie „Make America Great Again“, die angestrebte Wiederherstellung eines großrussischen Reiche oder Europa als Verteidigerin demokratischer, freiheitlicher Werte und einer pluralen Gesellschaft.
Gegen den Pluralismus gibt es zunehmend Kräfte, die alles Fremde ausgrenzen und ausmerzen wollen. Eine homogene Gesellschaft wie früher, die es in Wirklichkeit nie gegeben hat, wird angestrebt.
Aber selbst die, die eine freiheitliche Demokratie, Toleranz und eine plurale Lebensweise erhalten wollen, rufen nach der Einhaltung von „unseren“ Werten. Migranten brauchen daher mehr Wertekurse und migrantische Schüler:innen Orientierungsklassen, in denen sie „unsere“ Werte lernen. Pluralität ist gut, solange alle so denken, wie wir.
Je mehr sich die Kritik an Macht verstärkt, desto mehr steigt auf der anderen Seite auch der Wunsch nach dem „starken Mann“ an der Regierung, der endlich alles einfach durchsetzen kann. Dies führt gegenwärtig zur Herausbildung der so genannten „illiberalen Demokratie“, die eigentlich nur eine Vorstufe zur Diktatur darstellt.
Mit der Macht hat auch die Idee der Bemächtigung der Natur durch den Menschen zu tun. Während nun die einen gegen die Zerstörung der Natur durch den Menschen auftreten, sehen anderen überhaupt keinen Grund darin, die Umgestaltung der Natur für menschliche Zwecke zu beenden. Wollen die einen mehr zurück zu einer „natürlichen“ Lebensweise, was auch immer hier unter Natur verstanden wird, streben die anderen weiterhin nach mehr (matriellen) Wachstum. Bietet für die einen der Verzicht den eigentlichen Wohlstand, sehen ihn die anderen im Konsum, im Sammeln von Gütern.
Obwohl das gute Gefühl immer wichtiger wird und das Nicht-Kränken zur Norm erhoben wird, führen wir zunehmend mehr emotionalisierte Debatten. Sobald man die Ansicht eines anderen kritisiert, wird mit einem Großaufgebot an Emotionen reagiert. Natürlich ist man dann immer das Opfer, denn für seine Gefühle kann man ja nichts; der andere habe sie ja in einem hervorgerufen. Der andere wird zum Täter.
Wir leben in einer Zeit der Überemotionalisierung. In Werbung und Politik gilt es nicht, die Vernunft, sondern die Emotionen der Menschen anzusprechen. In politischen und gesellschaftlichen Diskursen regiert zunehmen die emotionale Verhärtung, in der die Kränkung und Herabwürdigung des anderen an der Tagesordnung steht.
Es ist eine widersprüchliche Zeit, in der wir leben. Aber jede Zeit hat ihre Widersprüche. Wir wissen nicht, welche Denkweisen dominanter sein werden. Und daher ist es für jetzt schwierig zu sagen, ob wir noch in der Moderne leben oder schon in der Zeit danach. Zukünftige Generationen werden das besser beurteilen können.