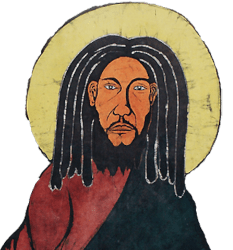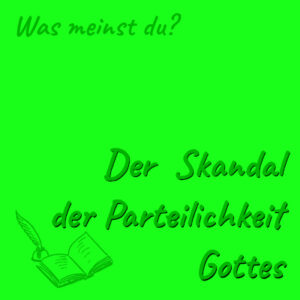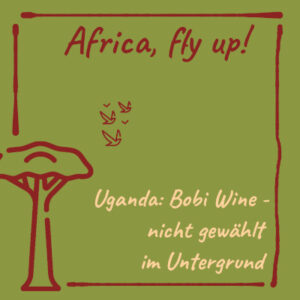Es gibt vier Evangelien. Daher gibt es auch viermal die Erzählung von der Kreuzigung Jesu. Aber immer gleich? Nein, es gibt gravierende Unterschiede, die mit der Theologie der Evangelisten zusammenhängen. Diese Episode geht diesen Unterschieden nach und eröffnet damit ein Feld verschiedener spiritueller Anknüpfungspunkte.
Hier ähnliche Podcasts
Transkript
Herzlich Willkommen zur 64. Episode.
In dieser Folge werde ich mit meinen Satz, der sich aus den Titeln der Fastenzeit-Folgen zusammensetzt, fertig. Er lautet dann: „An der Türschwelle des Lebens schaust du zurück und vermisst Gott bis ans Kreuz.“
Diese ganze Reihe hat darauf abgezielt, dass wir in einer Zeit des Übergangs leben, eben an der Türschwelle. Die Frage ist: Gehen wir gerade hinein oder hinaus? Beides ist möglich.
In jedem Fall gehen wir in eine Zukunft – und zwar gehen wir von einer Gegenwart aus, in der kein Gott da ist. Das lässt uns zurückschauen in die Vergangenheit, aus der uns die Erzählungen der Altvorderen übergeben wurden, die von den Machttaten Gottes sprechen.
Diese Erzählungen können uns Hoffnung für die Zukunft schenken – oder auch nicht. Sie lassen uns aber umso mehr Gott vermissen, der sich jetzt als der abwesende zeigt. Es spielt dabei keine Rolle, ob wir an seine Existenz glauben oder nicht: Wer sich der Leere bewusst ist, die der abwesende Gott hinterlässt, wird ihn vermissen. Diese Abwesenheit Gottes, dieses Vemissen, diese Gottverlassenheit geht mit ans Kreuz.
Am Kreuz – da geht es nicht mehr um Leben und Tod. Da geht es nur noch um den Tod. Diese unendliche, unvorstellbare Leere. Der eigene Tod ist die höchste Gewissheit dieser Leere, die unser Leben in einer ambivalenten Schwebe lässt. Diese Schwebe lässt die einen mehr in Richtung Hoffnung tendieren, die anderen mehr in Richtung Hoffnungslosigkeit und Absurdität.
Solange wir aber, so möchte ich es einmal ausdrücken, diese Leere aushalten und nicht mit schnellen Antworten zuschütten, bleiben wir am Puls des Lebens. Als solch schnelle Antworten habe ich den klassischen Atheismus und die Pseudo-Mystik bezeichnet. Sie vermitteln nicht lebendiges Leben, das sich seines Todes bewusst ist, sondern jetzt schon sterbendes Leben, das den Tod verdrängt.
Das sind vor allem die Themen der letzten beiden Podcast-Episoden gewesen.
Im Kreuzestod Jesu wird der Tod mit dem Vermissen Gottes zusammengebracht. Gerade an ihm wird gegenwärtig, wie abwesend Gott ist.
Doch sehen das alle Evangelisten so?
Wie viele andere Theologen möchte auch ich diese Tradition stark machen. Dennoch muss man sehen, dass die Evangelisten die Kreuzigung Jesu sehr unterschiedlich darstellen. So gibt es ganz verschiedene spirituelle Anknüpfungspunkte, die nicht über einen Kamm zu scheren sind. Die Darstellungen sollen nicht harmonisiert, sondern in ihrer Vielstimmigkeit wahrgenommen werden. So halten auch die Evangelien als Gesamtes die Deutung des Todes Jesu in der Schwebe und geben darüber keine eindeutige Antwort.
In der heutigen Episode möchte ich daher alle vier Kreuzigungsszenen aus den Evangelien nebeneinander stellen. Dabei sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu Tage treten. Dir kann es helfen, dich selbst bewusst einer Traditionslinie einzuschreiben – oder es eben in Schwebe zu halten, vielleicht auch einen ganz eigenen Zugang zu finden.
Ich werde dabei nicht nur auf die Erzählung von der Kreuzigung im engeren Sinn schauen, sondern auch sehr überblicksartig die Vorgeschichte von der Verhaftung weg erzählen. Dabei bin ich gezwungen, viele Details wegzulassen. Allein die Kreuzigung selbst soll detailiert betrachtet werden.
Ich empfehle dabei auch meine Podcast-Episode zur Auferstehung, denn auch da spielt die Kreuzigung eine entscheidende Rolle. Den Link dazu und zu anderen ähnlichen Episoden findest du in den Shownotes.
In den Shownotes findet du auch Links zu ko-fi und PayPal, mit denen du mich finanziell unterstützen kannst. Damit muss ich meine Arbeit nicht mit lästiger Werbung finanzieren. Ich bedanke mich bei allen treuen Hörerinnen und Hörern, die das schon getan haben. Außerdem freue ich mich immer auf’s Neue, wenn ich Nachrichten von euch bekomme.
So, und jetzt geht’s los.
Ich beginne beim Markus-Evangelium. Die Vorgeschichte kennen wir alle mehr oder weniger: Der Apostel Judas arbeitet an der Auslieferung Jesu mit, Jesus wird verhaftet, alle Jünger fliehen. Petrus folgt mit Abstand, verleugnet dann aber, ein Jünger Jesu zu sein. Jesus wird von den Jüngern völlig allein gelassen.
Er wird zuerst vor den jüdischen Hohenrat gebracht, dann zum römischen Statthalter Pilatus. Pilatus entscheidet, das Volk zwischen der Freilassung Jesu und der des Barabbas wählen zu lassen. Das Volk entscheidet: Jesus soll gekreuzigt werden. Dabei wird ausdrücklich gesagt, dass die jüdischen Führungspersönlichkeiten die Menge aufgewiegelt haben.
Jesus wird von den Soldaten verspottet. Dann folgt der Kreuzweg, auf dem Simon von Kyrene gezwungen wurde, Jesu Kreuz zu tragen.
Dann wird Jesus Wein mit Myrrhe geboten. Das sollte die Schmerzen betäuben. Jesus aber lehnt ab. Er stirbt bei vollem Bewusstsein.
Hier kommen unausgesprochen schon Frauen zum Vorschein, denn meist waren sie es, die den Verurteilten dieses Getränk gaben.
Dann kreuzigten die Römer Jesus und verteilten seine Kleider.
Eine Aufschrift gibt seine Schuld an: „Der König der Juden“.
Mit Jesus kreuzigten sie zwei Verbrecher, einen links, einen rechts. Von einem Gespräch, das wir alle kennen, erzählt Markus nichts. Er möchte einfach zeigen, dass Jesus zu den Verbrechern gezählt wurde.
Es kommen verschiedene Leute vorbei, die Jesus beschimpfen und verspotten. Auch die beiden Mitgekreuzigen verspotten Jesus.
Zur sechsten Stunde, also um 12 Uhr mittags, wird es Dunkel. Bis 15 Uhr. Dann schreit Jesus: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“
Da im Hebräischen das Wort für „mein Gott“, nämlich Eloi, so ähnlich klingt wie Elija, glaubten einige, er rufe zu dem Propheten Elija. Die Menschen verstehen Jesus nicht. Er sieht sich von Gott verlassen, die aber meinen, er rufe einen Propheten zur Rettung herbei. Elija, so der damalige Glaube, soll einst wiederkommen; er sei nämlich nicht gestorben, sondern – wie das Alte Testament berichtet – in den Himmel entrückt worden. Daher glaubte man, dass er am Ende der Zeit zur Rettung der Menschen wiederkommen werde. Darauf wird hier angespielt.
Einer lief hin und gab Jesus Essig zu trinken. Dies sollte als Erfrischung, nicht zur Betäubung gedacht sein.
Dann haucht Jesus seinen Geist aus.
Da riss der Vorhang im Tempel entzwei. Dieser trennte das Allerheiligste vom weltlichen Bereich. Der Vorhang diente zum Schutz vor der tödlichen Herrlichkeit Gottes. Dazu kann man mehr im Buch Exodus nachlesen.
Im Christentum wird dieses Ereignis als Aufhebung der Trennung zwischen Gott und Mensch gedeutet. Nun haben nicht nur Priester zutritt zu Gott, sondern alle. Es ist ein endzeitliches Zeichen und schon der erste Hinweis auf die Auferstehung Jesu, auf die todüberwindende Kraft Gottes.
Der römische Hauptmann sagt: „Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn.“
Erst zum Schluss erwähnt Markus die Frauen ausdrücklich: Viele Frauen sahen von Weitem zu. Während also die männlichen Jünger alle davongelaufen sind, hatten die Frauen soviel Mut und Courage, dass sie dabei blieben.
Ich komme nun zum Matthäus-Evangelium, das sehr nahe der Schilderung des Markus folgt, aber auch einige Unterschiede aufweist.
Zunächst ein paar Gemeinsamkeiten: Der Apostel Judas wirkt an der Auslieferung Jesu mit, alle Jünger fliehen, Petrus folgt von Weitem und verleugnet Jesus.
Jesus kommt zum jüdischen Hohenrat und dann zum römischen Statthalter Pilatus.
Jetzt schiebt Matthäus noch eine Erzählung ein: Er berichtet, wie Judas zu Tode gekommen ist. Dieser gab das Geld zurück und erhängte sich. Das Geld durfte aber nicht dem Tempelschatz zugeführt werden, da Blut daran klebte. So kauften die Hohenpriester einen Acker, in dem die Fremden begraben wurden.
Dann folgt das Verhör vor Pilatus. Wieder soll das Volk zwischen Jesus und Barabbas entscheiden. Matthäus fügt dem Barabbas aber noch einen zweiten Namen hinzu. So wird erst wirklich deutlich, worum es bei dieser Entscheidung geht. Matthäus nennt ihn nämlich „Jesus Barabbas“.
Das bedeutet: Das Volk wählt zwischen Jesus Barabbas und Jesus, den man den Christus nennt. Es wird jetzt also etwas verwickelt. Also Achtung: Dieser Jesus Barabbas wird von Matthäus nicht als Räuber oder Mörder bezeichnet – wie es die anderen Evangelien tun, sondern als „berüchtigter Mann“. Das Wort „berüchtigt“ kann aber auch „herausragend, prachtvoll“ bedeuten, also genau das Gegenteil.
Und noch etwas Sprachliches kommt hinzu: Barabbas bedeutet übersetzt „Sohn des Vaters“, wobei mit „abba“ genau jene Anrede für Gott verwendet wird, die Jesus – also unser Jesus – selbst verwendet.
Hier stehen also zwei berüchtigte – oder soll ich sagen: herausragende Männer zur Wahl, die eigentlich beide dieselben sind: Der eine ist Jesus, der Sohn des Vaters, und der andere ist Jesus, der Christus genannt wird. Ist da eigentlich noch ein Unterschied? Hat das Volk hier wirklich eine Wahl? Oder geht es nicht vielmehr darum, dass sich das erfüllen muss, was in den Schriften des Alten Testamentes gesagt wurde, wie Matthäus immer wieder betont? Nämlich dass der Gerechte Gottes leiden und getötet werden muss.
Wie dem auch sei: Am Ende wird entschieden, Jesus, den Christus, zu kreuzigen. Jesus wird wieder von den Soldaten verspottet. Wieder der Kreuzweg und wieder wird Simon von Kyrene gezwungen, das Kreuz zu tragen.
Auf Golgotha gab man ihm Wein vermischt mit – Achtung – Galle (nicht Myrrhe) und – wieder Achtung – Jesus kostete, wollte dann aber nicht trinken.
Jesus wird gekreuzigt und die Kleider verteilt. Die Aufschrift lautet bei Matthäus ausführlicher: „Das ist Jesus, der König der Juden“.
Wieder werden die zwei Verbrecher benannt, die nun als Räuber bezeichnet werden. Auch hier gibt es kein Gespräch Jesu mit ihnen.
Leute kommen vorbei und verspotten Jesus, auch die Mitgekreuzigten tun das.
Der Tod Jesu wird im Großen und Ganzen gleich erzählt wie bei Markus. Daher erspare ich mir das an dieser Stelle.
Matthäus fügt nur eine Erweiterung in seine Erzählung ein: Nachdem der Vorhang im Tempel gerissen war, schildert er, dass sich auch die Gräber öffneten und die Leiber vieler Heiliger auferweckt wurden. Sie werden bei der Auferstehung Jesu die Gräber verlassen.
Matthäus baut das endzeitliche Motiv des Markus also deutlich in Richtung der todüberwindenden, lebenspendenden Macht Gottes aus, die schon bei der Kreuzigung selbst geschieht.
Markus und Matthäus erzählen sehr ähnlich. Beide formulieren die Gottverlassenheit Jesu am Kreuz, sein Gottvermissen. Angesichts höchster Not zeigt sich Gott abwesend.
Beide formulieren mit den Zerreißen des Vorhanges und dem Öffnen der Gräber auch die Wende hin zum Leben.
Ich habe auch gesagt, dass der Tod Jesu als Aushauchen des Geistes bezeichnet wird. Andere Übersetzungen schreiben einfach vom Verscheiden Jesu. Was ist richtig? Wahrscheinlich beides. Im griechischen Original steht nur ein Wort: Wenn ich in der Übersetzung mehr den physischen Tod betonen will, dann sage ich „verscheiden“. Aber ich kann dieses Wort auch als „hinausgeistigen“ oder „hinausatmen“ deuten, denn in ihm steckt das Wort für „Geist“ bzw. „Atem“.
Jesus haucht dann jene göttliche Kraft aus, die er bei der Taufe erhalten hat, jene Kraft, die lebensspendend ist. Das gilt für beide Evangelisten, auch wenn Matthäus diese Kraft deutlicher schildert.
Wir kommen jetzt zum Lukas-Evangelium, das deutliche Unterschiede zeigt:
Auch bei Lukas wirkt Judas bei der Auslieferung Jesu mit. Jesus wird verhaftet.
Und jetzt folgt der erste deutliche Unterschied: Bei Lukas laufen die Jünger nicht davon. Lukas ist also den Jüngern gegenüber etwas freundlicher gesinnt.
Von Petrus heißt es wieder, dass er Jesus vom Weiten folgte und dass er ihn verleugnete. Auch in dieser Erzählung gibt es wieder eine Abweichung: Lukas fügt einen bemerkenswerten Satz ein: „Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an.“ (22,61) Das ist rein praktisch jedoch nicht möglich. Jesus war ganz woanders. Lukas will deutlich machen, wie sehr Petrus nach der Leugnung Jesus vor Augen hat.
Jesus kommt dann wieder vor den jüdischen Hohen Rat und dann wieder zum römischen Statthalter Pilatus.
Und schon folgt die nächste Abweichung: Lukas erzählt als einziger, dass Pilatus Jesus zu Herodes schickt. Der ist Jude, kollaboriert aber mit den Römern in Galiläa, der Herkunftsgegend von Jesus. Herodes schickt ihn nach seiner Befragung wieder zurück zu Pilatus.
Warum erzählt Lukas das? Er möchte deutlich machen, wie sehr sich die Mächtigen gegen Jesus verschworen haben. Er möchte die politischen Strategien darstellen. „An diesem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde; vorher waren sie Feinde gewesen.“ (23,12) schreibt Lukas ausdrücklich.
Das wird auch im nächsten Schritt deutlich. Pilatus bietet diesmal nicht an, dass man sich zwischen Jesus und Barabbas entscheiden solle. Die „Hohenpriester und andere führende Männer“ kommen von selbst auf die Idee, das von Pilatus zu fordern. Jetzt schreit nicht mehr das Volk nach der Kreuzigung Jesu, sondern die führende Elite des Landes. Pilatus fügt sich diesem Wunsch.
Lukas ist derjenige Autor, der besonders führungs- und elitenkritisch ist. Er sieht in ihnen die besondere Gefahr der Ausbeutung der kleinen Leute. Sie haben die Macht und den Einfluss, die Verhältnisse nach ihren wünschen zu gestalten. Das Volk hingegen hat diese Macht nicht. Daher nimmt es Lukas bei seiner Darstellung auch aus dem Schussfeld.
Gehen wir weiter zum Kreuzweg
Eine Verspottung durch die Soldaten fehlt, aber nicht, dass Simon von Kyrene gezwungen wurde, das Kreuz zu tragen.
Lukas baut in den Kreuzweg nun eine Szene ein, die wieder seine Volksnähe zeigt: Eine Menschenmenge folgt Jesus. Lukas ist ja der Feminist unter den Evangelisten. Daher streicht er auch hier besonders die Frauen hervor, die in der Menge waren. Jesus wendet sich direkt an sie: „Weint nicht über mich; weint vielmehr über euch und eure Kinder!“ (23,28)
Es folgt die Kreuzigung: Die beiden Verbrecher werden erwähnt, das Verteilen der Kleider und das Verspotten der Menschen.
Es fehlt aber jegliche Erzählung über irgendwelche Getränke. Also weder kommen Wein mit Myrrehe oder Galle noch Essig vor.
Aber der größte Unterschied ist wohl, dass Lukas zeigen möchte, das auch angesichtes des Todes Jesus dem Vater ganz vertraut. Hier geht er den gegenteiligen Weg als Markus und Matthäus.
Erster Hinweis dafür ist, dass Jesus vertrauensvoll zum Vater betet: „Vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun.“ (23,34)
Der zweite Hinweis ist das Gespräch mit den Verbrechern, das es nur bei Lukas gibt: Einer von ihnen spottet über Jesus, der andere bittet ihn um Gnade. Jesus sagt dem zweiteren zu, noch heute mit ihm im Paradies zu sein. Hier spricht sich also nicht nur die Gnade gegenüber dem reuigen Verbrecher aus, der vielleicht auch nur einer war, der unter die Räder der Mächtigen gekommen ist, sondern auch das Vertrauen Jesu auf diesen Gott.
Der Tod Jesu wird ganz kurz geschildert: Von der sechsten bis zur neuen Stunde Finsternis. Dann der laute Ruf zu Gott: „Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist.“
Der Schrei nach Gottverlassenheit fehlt bei Lukas völlig. Er würde auch nicht zum Vertrauen Jesu passen. Vielmehr gibt Jesus nun das an Gott zurück, was er bei der Taufe von ihm erhalten hat, seine lebensspendende Kraft. Für Lukas spielt also der Geist eine besondere Rollen. Der Geist, der auf die Jünger:innen später herabkommen wird.
Der zerrissene Vorhang im Tempel kommt zwar vor, aber weggelassen hat er die Öffnung der Gräber wie bei Matthäus.
Der römische Hauptmann bekennt Jesus nicht als Gottes Sohn, sondern als gerechten Mensch. Andere kommen und schlagen sich zum Zeichen der Schuld an die Brust.
Entgegen Markus und Matthäus sagt Lukas, dass nicht nur die Frauen, sondern auch andere Bekannte von Weitem der Kreuzigung zugesehen haben. Wie gesagt: Lukas ist hier jüngerfreundlich – im Gegensatz zu Markus und Matthäus.
Den Tod des Judas schildert Lukas erst in der Apostelgeschichte, aber anders als Matthäus: Judas hat sich einen Acker gekauft, ist dort zu Sturz gekommen und alle Eingeweide sind herausgefallen.
Auch im Johannes-Evangelium ist Judas derjenige, der an der Verhaftung mitwirkt. Auch hier steht nichts von einer Jüngerflucht. Das hat bei Johannes vor allem damit zu tun, dass für ihn die Jünger gar nicht so wichtig sind. Er kennt keine zwölf Apostel und also auch keine Auswahl der Zwölf. Nur einzelne Apostel werden namentlich genannt. So eben Judas und auch Petrus, der bei Johannes ebenso Jesus verleugnet.
Abweichend zu den anderen drei Evangelisten, wird Jesus zuerst zu Hannas gebracht. Er ist der ehemalige Hohepriester und verhört Jesus als erstes. Er ist quasi die Graue Eminenz im Hintergrund.
Danach wird Jesus zu Kajaphas, dem Schwiegersohn des Hannas und aktuellen Hohenpriester geschickt. Erst dann kommt er zu Pilatus.
Eine Übergabe an Herodes wird nicht erzählt.
Bei Pilatus ergibt sich ein rechtes Hin und Her zwischen den Juden draußen und dem Verhör Jesu drinnen. Hier ist das Wort „Jude“ wichtig, dass bei den anderen Evangelisten nicht vorkommt. Das Johannes-Evangelium – naja, wie soll man sagen – zeichnet sich durch seinen Antijudaismus aus. Während also Markus und Matthäus eher berichten und Lukas seine Erzählung sehr elitenkritisch und jüngerfreundlich umbaut, lässt Johannes ganz deutlich seine Antipathie gegen die Juden sprechen. Das hat zeitgeschichtliche Hintergründe, auf die ich jetzt nicht eingehen kann. Wichtig in unserem Zusammenhang ist nur, dass nicht ganz klar ist, ob mit Juden hier konkret nur die Führungselite oder das ganz Volk gemeint ist. Von einer Aufwiegelung des Volkes durch die Führung lesen wir jedenfalls nichts.
Dieser antijüdische Impetus wird auch in der Persönlichkeit des Pilatus wichtig. Noch deutlicher als bei allen anderen Evangelisten wird jede Schuld von ihm genommen. Er tut alles, um Jesus frei zu lassen. Zudem wird Pilatus nicht als politischer Stratege, wie bei Lukas geschildert, sondern als ängstlich und als Instrument der Juden. Sie drohen ihm, dass er sich gegen den Kaiser, also seinem Chef wendet, wenn er Jesus nicht töten lässt.
Aber es kommt noch eine ganz andere Ebene hinein: Gegenüber Jesus gibt Pilatus zu verstehen, dass er die Macht über sein Leben und Tod hat. Jesus weist ihn zurecht: Er hätte diese Macht nicht, wenn sie nicht von Gott gegeben wäre. Wer hier also wirklich kreuzigt, ist weder Pilatus noch sind es die Juden, sondern Gott selbst ist es.
Bei Johannes ist Jesus nicht Opfer politischer Umstände, wie es vor allem Lukas schildert, sondern der Täter seines eigenen Todes. Gott bzw. Jesus haben das Heft in der Hand.
Gehen wir weiter.
Wie schon bei Lukas ist die Wahl zwischen Jesus und Barabbas nicht die Idee von Pilatus, sondern von den Juden. Jesus wird zuerst gegeißelt und nach weiterem Hin und Her endgütig gekreuzigt.
Der Weg zur Kreuzigung und die Kreuzigung selbst werden nur kurz geschildert. Es fehlen: Simon von Kyrene, die Menge und die Frauen, die verschiedenen Getränke, die Verspottungen und die beiden Verbrecher. Johannes beschreibt eine ganz andere Kreuzigung.
Das hat damit zu tun, dass ihm nicht die historischen Ereignisse interessieren, sondern er seine Sicht auf Jesus darstellen möchte, seine Theologie.
Daher wird auch die Diskussion um die Tafel ausgeführt. Hier steht nun auf der Tafel: „Jesus von Nazareth, König der Juden“. Also das, was auch auf unseren heutigen Kreuzesdarstellungen steht.
Auch das Gewand wird verteilt. Aber nur bei Johannes wird erwähnt, dass das Untergewand keine Naht hat. Will sagt: Jesus ist ohne Naht. Er ist perfekt, ohne Makel und wertvoll.
Dann folgt die Szene, mit der wir Maria und Johannes verbinden. Das muss ich näher ausführen: Bei den anderen Evangelisten steht kein Jünger Jesu unter dem Kreuz, die haben sich entweder alle verdrückt oder schauen von Weitem zu. Der Evangelist Johannes hingegen positioniert zwei wichtige Personen unter das Kreuz. Aber welche?
Der eine ist nicht Johannes, sondern der Jünger, den Jesus liebte. Er wurde erst später mit dem Apostel Johannes identifiziert, wodurch das Evangelium seinen Namen erhielt. Dieser Jünger ist eine historische Figur, aber auch eine theologische Variable: Er gilt als Zeuge, der alles wahr bezeugt. Auch wenn es einen solchen Jünger gegeben hat, steht er zugleich symbolisch für all jene, die ein wahres Zeugnis abgeben.
Die andere Person unter dem Kreuz soll Maria sein. So die Tradition. Allerdings nennt das Johannes-Evangelium an keiner Stelle den Namen der Mutter Jesu. Sie wird eben immer nur als Mutter Jesu bezeichnet. Im Evangelium spielt sie nur bei der Hochzeit von Kana und dann bei der Kreuzigung eine Rolle. Ansonsten heißt es nur von ihr, dass sie Jesus gefolgt sei. Das kennen wir aus den anderen Evangelien nicht.
Wir können also folgern: Wenn der Jünger, den Jesus liebte, eine symbolische Leerstelle ist, ist es vielleicht auch die Mutter. Sie ist diejenige, die auf Jesus verweist: „Was er euch sagt, das tut“, so bei der Hochzeit.
Es handelt sich also um zwei Figuren, die auf Jesus verweisen, ihn bezeugen.
Wie auch immer: Jedenfalls stirbt Jesus hier nicht ohne Gefolgsleute. Zwei sind da und die verweisen auf Jesus, den Sterbenden.
Dann folgt die Sterbeszene und wieder hat Jesus das Heft in der Hand. Auf seine Anweisung hin bekommt er Essig. Seine Anweisung lautet einfach: „Mich drüstet.“
Dann sagt er „Es ist vollbracht.“ (19,30). Jesus ist nun klar, dass er alles getan hat, was zu tun ist. In diesen Worten spiegelt sich die Aktivität Jesu wieder. Er lässt nicht mit sich etwas tun, sondern alles, was geschieht, ist Tat Gottes bzw. Jesu. Nun ist alles von ihm getan worden. Also kann er sterben.
Wer also Jesus als Opfer sehen möchte, kann sich nicht auf das Johannes-Evangelium berufen. Der wäre am besten auf Lukas verwiesen. Wer aber Jesus als den Herrscherlich-Herrlichen sehen möchte, der muss sich auf Johannes berufen. Hier zeigt sich der deutlichste Unterschied zwischen Johannes und den anderen Evangelien.
Nach seinen letzten Worten übergab er seinen Geist. Wieder wird dasselbe Wort verwendet, über das ich schon gesprochen habe, das sowohl „verscheiden“ als auch „aushauchen“ bedeutet.
Von einem Unterschied habe ich noch gar nicht gesprochen: Wann ist Jesus eigentlich gestorben?
Vom Wochentag her sagen wir, dass es ein Freitag gewesen sein soll. Das bezieht sich auf das Markus-Evangelium, das die Kreuzigung auf den Rüsttag legt. Dieser Tag bezeichnet den Vortag eine Festes, an dem man sich vorbereitet. So war jeder Freitag ein Rüsttag, weil er vor dem Sabbat kommt.
Wie ist es aber nach jüdischer bzw. religiöser Zeitmessung? Markus, Matthäus und Lukas berichten vom Letzten Abendmahl, das ein Paschamahl war. Dieses erinnert die Juden an die Rettung aus der Sklaverei durch Mose. Der Tod Jesu wird also mit der Rettung Israels in Verbindung gebracht. Die Kreuzigung findet dann am Tag nach dem Paschamahl statt.
Daraus können wir keinen Wochentag schließen, da das Paschafest unabhängig von den Wochentagen ist. Und wir wissen ja auch das Todesjahr nicht. Würden wir es wissen, würden wir auch den Wochentag wissen.
Bei Johannes ist es allerdings anders: Er schreibt explizit, dass Jesus am „Rüsttag des Paschafestes“ (Joh 19,34) gekreuzigt wurde. Das kann natürlich auch ein Freitag sein. Aber es ist nicht der Tag nach dem Paschafest, sondern der Tag davor. Der Tod Jesu ist also nach Johannes die Vorbereitung zur Rettung.
Jetzt fragt ihr wahrscheinlich: „Was ist dann mit dem Letzten Abendmahl?“ Das gibt es bei Johannes so nicht. Es wird von einem Mahl gesprochen, aber davon wird nur die Fußwaschung erzählt, die bei keinem andere Evangelisten vorkommt, und außerdem wird dieses Mahl ausdrücklich vor dem Paschafest angesetzt (13,1).
Jesus ist also wahrscheinlich auf einem Freitag, entweder am Tag vor oder nach dem Paschafest gekreuzigt worden.
Wie ich eingangs gesagt habe, sind die unterschiedlichen Traditionen Ausgangspunkte unterschiedlicher Spiritualitäten:
Die Spiritualität von Teresa von Kalkutta zum Beispiel speist sich ganz aus der Tradition des Johannes. „Mich dürstet“ versteht sie so, dass Jesus nach Seelen dürstet, also nach Menschen, die an ihn glauben.
Eine Spiritualität von Franz und Klara von Assisi wiederum lebt im Kern ganz aus dem Vertrauen auf Gott, wie es im Lukas-Evangelium angesprochen wird.
Die Gottverlassenheit bei Markus und Matthäus ist wiederum Kern vielfältiger Spiritualitäten wie der karmelitischen „Dunklen Nacht“, dem Erleben Dietrich Bonhoeffers oder der Theologie nach Auschwitz.
Wer ist also Jesus für dich? In welche Tradition willst du dich einschreiben? Welchen eigene Zugang selbst entdecken?
Ist Jesus das Opfer, das unter die Räder gekommen ist, der an der Seite der Kleinen gegen die Mächtigen steht, oder ist er der eigentliche Machthaber, der sogar sein eigenes Sterben gelenkt hat?
Ist Jesus gott- und menschenverlassen gestorben oder im vollen Vertrauen auf Gott oder als herrlicher König?
Vermisst Jesus Gott am Kreuz oder übergibt er sich vertrauensvoll in seine Arme oder hat er letztlich das Heft des Handelns in der Hand?
Und wo stehst du? Bist du davongelaufen oder siehst du von Weitem zu oder stehst du mit der Mutter Jesu und dem Jünger, den Jesus liebte, unter dem Kreuz und zeigst auf ihn?
Ich mache abschließend keinen Hehl aus meinem Zugang, der in den letzten Folgen schon deutlich geworden ist: Ich meine, dass unsere Zeit und vor allem das gegenwätige Christentum es nötig hat, sich der Abwesenheit Gottes zu stellen. Das ist keine angenehme Situation, denn sie bedeutet, dass jedes Wort zuerst verstummen muss, bis wir wieder etwas zu sagen haben.
Wir stehen an der Türschwelle, an der Schwelle der Entscheidung, hinein oder hinaus zu gehen, in die Vergangenheit und Zukunft zu blicken, hoffnungsvoll oder hoffnungslos – aber immer einen Gott vermissend.