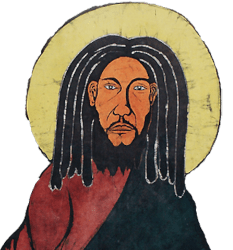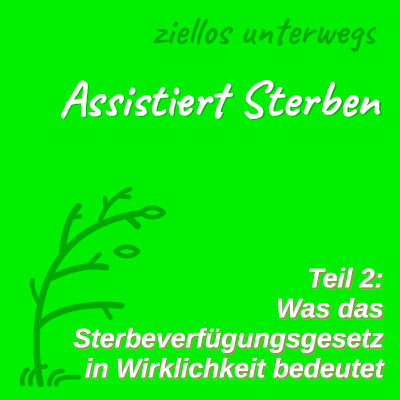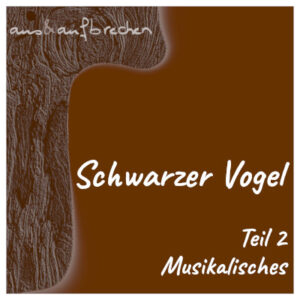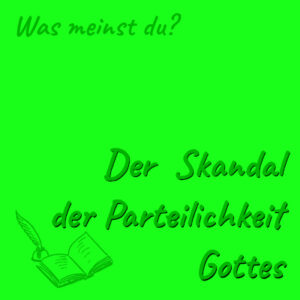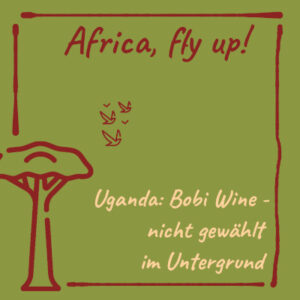„Ich möchte die Menschen darüber informieren, dass man auch in Österreich selbstbestimmt sterben kann, wenn man unheilbar krank ist“, sagt Niki Glattauer in seinem Interview mit der Wiener Wochenzeitung Falter und dem Online-Portal Newsflix Anfang September und nimmt damit Bezug auf das Sterbeverfügungsgesetz. Und damit hat er Unrecht. Was dieses Gesetz in Wirklichkeit bedeutet, das erfährst du in diesem Beitrag.
Es handelt sich dabei um den zweiten Teil (Link zum ersten Teil) meiner Auseinandersetzung mit dem assistierten Suizid, wie er in Österreich seit 2022 möglich ist.
Selbstbestimmt sein Leben führen – wer möchte das nicht? Selbstbestimmung scheint der oberste Wert unserer Gesellschaft zu sein – so sehr, dass der Mensch keine Vorgaben mehr zu akzeptieren scheint. Nichts soll von anderen und von anderem, alles soll von einem selbst bestimmt werden. Selbstbestimmung ist ein individuelles Recht, ein Recht des Einzelnen, über sich selbst bestimmen zu können.
Ein Leben in Selbstbestimmung – so scheint die Mehrheitsmeinung zu besagen – bedeutet auch, sein Sterben selbst bestimmen zu dürfen. Dazu gibt es seit 2022 in Österreich ein Gesetz, das dieses selbstbestimmte Sterben ermöglichen soll: das Sterbeverfügungsgesetz. Seit diesem Zeitpunkt – so die Mehrheitsansicht, die auch Niki Glattauer in seinem Interview wiedergibt – ist selbstbestimmtes Sterben in Österreich möglich.
Diese weit verbreitete Ansicht stimmt jedoch so nicht. Ich möchte erklären, warum nicht. Und was das Sterbeverfügungsgesetz in Wirklichkeit bedeutet.
Suizid: gesetzlich seit dem 19. Jahrhundert erlaubt!
Wenn jetzt so getan wird, als ob selbstbestimmtes Sterben erst seit 2022 – also mit der Einführung des Sterbeverfügungsgesetzes – möglich sei, dann setzt das die Ansicht voraus, zuvor wäre (juristisch gesehen) kein selbstbestimmtes Sterben möglich bzw. erlaubt gewesen.
So gut wie jeder weiß, dass das gerade nicht der Fall war. Ganz im Gegenteil, ist der Suizid seit ca. 200 Jahren in Österreich nicht verboten. Juristisch ist der Suizid und scheinbar damit verbunden, selbstbestimmtes Sterben, seit langem erlaubt.
Maria Theresia schloss sich der katholischen Sichtweise an, dass der Suizid eine moralische Verfehlung bzw. Sünde sei. Daher wurde er durch entehrende Schandbestattungen bestraft. Menschen, die einen Suizidversuch begangen hatten, wurden mit Freiheitsstrafen, körperlicher Züchtigung oder Kirchenbuße belegt.
Wurden diese Schandbestattungen kirchlicherseits noch bis weit ins 20. Jahrhundert praktiziert, dachte schon der Sohn Maria Theresias, Joseph II., anders. Für ihn war der Suizid ein gesundheitliches Problem, und daher wurden mit der Zeit alle Strafsanktionen sowohl gegen Suizidenten als auch gegen jene, die einen Suizid versucht hatten, abgeschafft. Dies wurde im Strafgesetz 1852 definitiv festgeschrieben.
Man könnte also sagen: Juristisch gesehen haben die österreichischen Staatsbürger seit ca. 200 Jahren die Erlaubnis, ihrem Leben selbst ein Ende zu setzen. Selbstbestimmung ist also schon lange möglich. Aber auch diese Sichtweise stimmt so nicht.
Von Selbstbestimmung keine Rede!
Wir müssen uns fragen, was Joseph II. dazu veranlasste, den Suizid aus dem moralischen Kontext zu lösen und ihn in den Gesundheitsbereich zu verlagern: Es waren die neuesten medizinischen Theorien über Suizid, die ihn als Folge der Melancholie sehen. Durch Ernährung und Lebensweise entstehe ein Überschuss an schwarzer Galle, der zur Melancholie und diese zu Suizidgedanken führen.
Aber diese humoralpathologische Erklärung ging zu Zeiten Joseph II. zu Ende. Aufgeklärtere Ärzte sahen den Suizid als Folge von Geistesstörungen an.
Eine weitere Vertiefung dieser Sachlage ist nicht notwendig, um eines zu sehen: Die „neuen“ Suizidtheorien sind weit davon entfernt, den Suizid als Ausdruck von Selbstbestimmung zu sehen. Ganz im Gegenteil: Suizidgedanken und Suizid werden den Menschen aufgrund eines Krankheitsbildes aufgezwungen.
Die Verschiebung von der Moral zur Medizin hatte nicht zur Folge, dass der Suizid zum Akt der Selbstbestimmung wurde, sondern dass die Fremdbestimmung vom Recht zur Pathologie wechselte. Der Suizid musste konsequenterweise aus dem Strafrecht entfernt werden, da der Mensch nicht mehr als Herr über sich selbst, als selbstbestimmt, angesehen wurde. Der Suizid wurde erst jetzt als Phänomen der Fremdbestimmung wahrgenommen. Denn solange er als Ausdruck moralischer Verfehlung galt, setzte man voraus, dass der Mensch frei genug sei, sich anders entscheiden zu können.
Wenn wir also heute bei diesem Thema eine Rückkehr von Moral und Ethik wahrnehmen, dann deshalb, weil der Suizid heute wieder als selbstbestimmte Tat verstanden wird. Wir kehren also zu einem Verständnis zur Zeit vor Josef II. zurück – mit dem Unterschied, dass allein der Akt der Selbstbestimmung die Tat gutheißt und nicht die mehr, die Übereinstimmung mit einem göttlichen Willen.
Nehmen wir nun an, dass die suizidale Person unter einem pathologischen Zwang steht, und nehmen wir gleichzeitig an, dass Selbstbestimmung ein hoher Wert ist, dann sind wir ethisch aufgefordert, die erkrankte Person zu heilen. Nur Heilung führt nämlich aus dem Zwang heraus, und nur dann gewinnt der Kranke wieder die Fähigkeit zur Selbstbestimmung.
Kurzum: Suizidprävention wäre geboten! Menschen müssten zum gesunden Leben geführt werden, denn nur das gewährleistet Selbstbestimmung.
Dieser Grundsatz gilt in der Suizidprävention bis heute. Mit dem Sterbeverfügungsgesetz erfolgt nun ein Paradigmenwechsel: Der Suizid wird wie vor den Zeiten Josefs II. als Ausdruck von Freiheit gesehen. Nur wird er nun nicht mehr als eine moralische Verfehlung gesehen, die der Staat zu verhindern habe, sondern als legitime Entscheidung, die der Staat unterstützen muss.
Hilfe zur Selbstbestimmung!
Das Verfassungsgericht hob am 11. Dezember 2020 das Verbot zur Suizidhilfe als verfassungswidrig auf. Ein kurzer Auszug aus der Begründung:
„Dieses Recht auf freie Selbstbestimmung umfasst das Recht auf die Gestaltung des Lebens ebenso wie das Recht auf ein menschenwürdiges Sterben. Das Recht auf freie Selbstbestimmung umfasst auch das Recht des Suizidwilligen, die Hilfe eines dazu bereiten Dritten in Anspruch zu nehmen.“ (Quelle)
Das Verfassungsgericht geht in seiner Urteilsbegründung davon aus, dass der Sterbewunsch Ausdruck einer Selbstbestimmung sein kann. Mit anderen Worten: Es setzt in Hinblick auf die Selbstbestimmung zwei Kategorien von Sterbewünschen voraus: jene, die aus einem pathologischen Zwang entstehen, und jene, die aus freiem Entschluss erfolgen. Das Gericht sieht also die Notwendigkeit, dass der Gesetzgeber prüft, ob das eine oder das andere der Fall ist.
Damit löst sich auch die Verallgemeinerung des suizidpräventiven Paradigmas auf: Nicht jeder Suizid ist pathologisch.
Keine Selbstbestimmung ohne Fremdbestimmung!
Von daher scheint man zu Recht sagen zu können, dass durch das Sterbeverfügungsgesetz der Suizid als Akt der Selbstbestimmung geworden ist. Der Pathos, mit dem das Urteil des Verfassungsgerichtes als Etablierung des Selbstbestimmungsrechtes im Sterben gefeiert wird, übersieht allerdings einen entscheidenden Punkt: Denn die Kernfrage war ja nicht, ob man selbstbestimmt sterben darf. Das Verfassungsgericht setzt nämlich einfach voraus, dass es selbstbestimmte Suizide gibt. Es greift damit weniger auf wissenschaftliche Erkenntnisse und mehr auf gesellschaftliche Neubewertungen des Suizides zurück.
Die Kernfrage war also nicht die nach der Selbstbestimmung, sondern nach der Hilfeleistung. Mit anderen Worten: Zu Debatte stand nicht, ob ich mir das Leben nehme, sondern ob ich dafür Hilfe von anderen in Anspruch nehmen darf. Und was lange verboten war, wird nun erlaubt.
Das bedeutet aber auch, dass die Ausübung meines Selbstbestimmungsrechtes abhängig ist von Vorgaben, über die ich gerade nicht bestimmen kann. Diese Vorgaben liegen auf ganz verschiedenen Ebenen: Das Verfahren zur Errichtung einer Sterbeverfügung ist gesetzlich geregelt; die (psychologischen?) Bedingungen, unter denen eine Person ihr Recht ausüben kann, sind festgelegt und müssen von Fachexperten überprüft werden; die helfende Person muss ihrer Aufgabe zustimmen; es gibt keine Wahl des Suizidmittels; die sterbewillige Person muss finanziell entsprechend ausgestattet sein.
Mit anderen Worten: Keine Selbstbestimmung ohne Fremdbestimmung. Oder, etwas genauer betrachtet: Dem Selbstbestimmungsrecht wird nur ein sehr kleiner Rahmen gegeben, in dem es ausgeübt werden kann.
Ich sehe hier also keinen Grund, dieses Gesetz als Errungenschaft zu mehr Selbstbestimmung abzufeiern. Reale Selbstbestimmung ist (juristisch betrachtet) kein Akt, der im absolut luftleeren Sozialraum vollzogen wird, sondern setzt Fremdbestimmung voraus.
Zwischenfazit: Das Sterbeverfügungsgesetz räumt nicht ein, selbstbestimmt sterben zu dürfen. Das wurde ja durch die Gesetzeslage zuvor auch nicht ausgeschlossen, obwohl das suizidpräventive Paradigma uneingeschränkt galt. Das Sterbeverfügungsgesetz räumt ein, dafür Hilfe in Anspruch nehmen zu dürfen. Dabei wird stillschweigend vorausgesetzt, dass die Ausübung des Selbstbestimmungsrechtes auf Voraussetzungen ruht, die nicht von der Betroffenen selbst bestimmt werden.
Suizidal oder sterbewillig?
Das Verständnis vom Suizid als moralische Verfehlung hat mit der Pathologisierung des Suizides eine Gemeinsamkeit, nämlich im Umgang: Suizide sind zu vermeiden!
Durch das Urteil des Verfassungsgerichtes und das Sterbeverfügungsgesetz brechen nun zum ersten Mal mit diesem Grundsatz. Nun gilt: Nicht alle Suizide sind zu vermeiden; manche müssen sogar unterstützt werden.
Möglicherweise haben Philosophen wie Mainländer, Nietzsche oder Camus Einfluss auf die Veränderung des geistigen Klimas gehabt, sodass mit dem jahrhundertealten suizidpräventiven Paradigma Schluss gemacht wurde.
Nun steht die Gesetzgeberin aber vor einem Problem: Wenn es zwei Arten von Sterbewünschen gibt, einen pathologischen und einen selbstbestimmten, muss sie auch die Kriterien an die Hand geben, diese zwei Arten unterscheiden zu können. Der Staat muss ausschließen, dass der Sterbewunsch aus psychischem Zwang geschieht. Nur dann kann er als selbstbestimmter Akt anerkannt werden.
Soziale und finanzielle Zwänge bleiben dabei unbeachtet. Hingegen sind körperliche Zwänge das zentrale Motiv, um das sich alles dreht. Was meine ich damit? Seit Jahrzehnten wird die Möglichkeit des assistierten Suizids (und der Sterbehilfe) deshalb diskutiert, weil man befürchtet, aufgrund einer körperlichen Erkrankung qualvoll sterben zu müssen. Die Suizidhilfe ermöglicht, Qualen von vornherein zu vermeiden.
Mit anderen Worten: Der Körper mit seinen krankhaften Entwicklungen zwingt sich uns auf; der Staat organisiert eine, von vielen als menschenunwürdig empfundene Behandlung und Versorgung der Patienten; Leiden und Siechtum sollen – so die allgemeine Ansicht – nicht mehr angenommen, sondern vermieden werden.
Zwingt sich da nicht gerade der Gedanke auf, seinem Leben vorzeitig ein Ende zu setzen? Folgt der Sterbewunsch nicht zwangsläufig aus dieser Situation, aus der es kein Entrinnen gibt? Wie selbstbestimmt ist also die Entscheidung zum Suizid dann eigentlich noch?
Die Gesetzgeberin – und viele Befürworter des Sterbeverfügungsgesetzes – tut so, als ob der Mensch abseits seiner Situation eine souveräne Entscheidung treffen könne. Dies ist aber ein Widerspruch: Denn die Entscheidung fußt ja auf der konkreten Situation, mit der sie begründet wird, und der man eben nicht souverän enthoben ist.
Einmal abgesehen von psychiatrischen Erkrankungen will ja jede sterbewillige Person auch gute Gründe für den Sterbewunsch anführen, Gründe, aus denen sich zwangsläufig der Todeswunsch rational rechtfertigt. Im Akt der Selbstbestimmung will man sich dem Zwang guter Argumente unterwerfen. Und diese Argumente sind meist die Vermeidung großer Leiden, aber auch ein Gesundheitssystem und eine soziale Umgebung, in denen sich Menschen nicht mehr würdevoll behandelt sehen. So werden aus bloßen Argumenten situative Zwangslagen, die den Sterbewunsch hervortreten lassen. Wo ist da also die viel beschworene Selbstbestimmung?
Es handelt sich hier um eine Verkennung oder Idealisierung der Selbstbestimmung, die sich über die Zwanghaftigkeit der konkreten Situation und des Lebens im Allgemeinen keine Aufklärung gibt. Es ist vielmehr eine unaufgeklärte Sichtweise von Selbstbestimmung.
Der Staat unterstützt das Sterben
Wurde in einem festgelegten Verfahren festgestellt, dass ein Mensch selbstbestimmt sterben möchte, wird er dabei auch vom Staat unterstützt, der ihm nun ein Suizidmittel zur Verfügung stellt. Selbstverständlich nicht kostenlos. Aber ohne das vorgesehene Verfahren kann man das Suizidmittel legal nicht erhalten. Mit dem Suizidmittel verbindet der Staat auch das Versprechen, dass der Tod sicher und ohne Qualen herbeigeführt wird. Fehler oder Missgeschicke bei der Anwendung bleiben unerwähnt.
Schon das Verfassungsgericht verbindet mit dem Selbstbestimmungsrecht, dass der Staat ein praktikables und sicheres Mittel zur Verfügung stellen soll.
Wieder haben wir es mit einer Einschränkung der Selbstbestimmung zu tun. Denn das zur Verfügung gestellte Suizidmittel ist keine Option, sondern eine Vorgabe. Vor allem für die helfende Person. Der Sterbewillige kann ja sterben, wie er möchte. Aber die helfende Person darf ihm nur jenes Mittel besorgen. Der Kauf eines Seils, die Besorgung einer Schusswaffe oder das Hinbringen zu einer Brücke sind ausgeschlossen; die helfende Person würde sich einer Straftat schuldig machen.
Was der Staat in Wirklichkeit tut
Das Verfassungsgericht und damit auch die Gesetzgeberin gehen davon aus, dass die Bürger die Selbstbestimmung im Sterben nicht erst durch ein Gesetz erhalten. Vielmehr kommt ihnen das Recht – als quasi Naturrecht oder Menschenrecht – schon zu; die Gesetzgeberin muss dem nur noch den passenden gesetzlichen Rahmen geben.
Daher ist das Sterbeverfügungsgesetz nicht die Einführung des Selbstbestimmungsrechtes, sondern die juristische Anerkennung desselben.
In dieser Anerkennung sind aber zwei Implikationen enthalten, die geflissentlich übersehen werden:
- Wie schon oben ausgeführt, geht es weniger um die Entscheidung des Sterbewilligen, sondern mehr um die Rechte der helfenden Personen. Es geht darum, den Unterschied zwischen pathologischen und selbstbestimmten Sterbewunsch zu unterscheiden und damit einer Person das Recht einzuräumen, beim Suizid einer anderen Person zu helfen.
- Dies bezieht sich auch auf den Staat selbst: Er erteilt sich in diesem Verfahren selbst die Erlaubnis, alle suizidpräventiven Maßnahmen zu stoppen und im Gegenzug ein Suizidmittel zur Verfügung zu stellen. Mit diesem Gesetz erteilt der Staat sich selbst eine Erlaubnis. Und für diese Selbsterlaubnis müssen die Betroffenen hohe Summen zahlen.
Neue Regeln für das Über-Ich
Abschließend komme ich nochmals auf das suizidpräventive Paradigma zu sprechen, dass jeder Suizid zu verhindern sei, welches Jahrhunderte gegolten hat. Es wurde von so gut wie allen gesellschaftlichen Institutionen vertreten, wenngleich auch nicht immer aus denselben Gründen. So haben die christlichen Konfessionen erst sehr spät den Suizid als pathologisches Problem gesehen, während sie ihn bis heute auch als moralisches Thema besprechen.
Wie dem auch sei: Psychoanalytisch gesprochen, hat sich in unserem Über-Ich daher die Regel festgebissen: Suizide sind zu verhindern. Im Über-Ich wird das Paradigma wiederum zum moralischen Gebot, zur ethischen Norm.
Gesetzliche Veränderungen sind Ausfluss gesellschaftlichen Wandels. Zugleich wirken diese aber auf jene zurück. Anders gesagt: Neue Gesetze bestimmen den gesellschaftlichen Wandel mit.
Und so kam und kommt es nun auch zu einer mehr oder weniger raschen Veränderung im Über-Ich der Menschen. Das suizidpräventive Paradigma wurde und wird zunehmend in Frage gestellt, und eine neue moralische Norm breitet sich aus: Wir müssen Menschen beim Sterben helfen, wenn sie es wünschen.
Meine These ist: Die Euphorie über das Sterbeverfügungsgesetz als Anerkennung von Sterbewünschen entsteht nicht durch den Inhalt des Gesetzes, sondern durch das neue Paradigma, des Staates, der in seiner Über-Ich-Funktion neue moralische Regeln in die Köpfe der Menschen einpflanzt – oder zumindest verstärkt.
Ohne Ethik geht es nicht!
Fazit: All das ist für mich ein Beispiel dafür, wie sehr wir uns selbst belügen. Das Sterbeverfügungsgesetz hat nicht mehr Selbstbestimmung gebracht, sondern ist Ausdruck einer neuen Sichtweise auf Suizid. Die übersteigerte Euphorie über Selbstbestimmung, die alle gesellschaftlichen Bereiche immer weiter durchzieht, übersieht, wie sehr reale Entscheidungen auf unverfügbaren Vorgaben, auf situativen Zwangslagen und selbstbestimmten Entscheidungen anderer fußen.
Die Frage, der wir uns eigentlich stellen sollten, ist nicht die nach mehr Selbstbestimmung, sondern die, wo die Grenze liegt zwischen Vorgaben akzeptieren und Vorgaben verändern, zwischen Annahme von und Engagement gegen existenziell herausfordernde Lebensereignisse. Und diese Grenze sollte nicht bei der Machbarkeit oder den juristischen Regelmöglichkeiten gezogen werden, sondern bei dem, was ethisch das Richtige ist, so schwierig diese Frage auch sein mag. Ohne Ethik kommen wir in Lebens- und Sterbefragen nicht weiter.