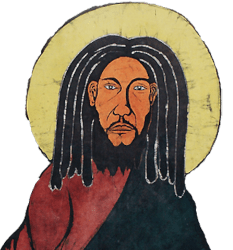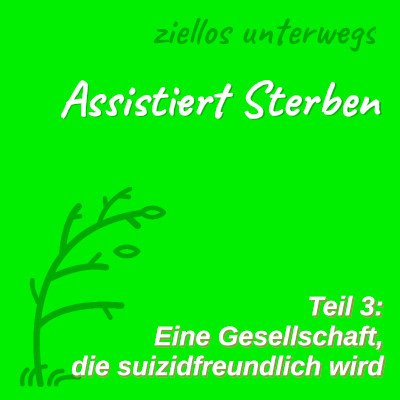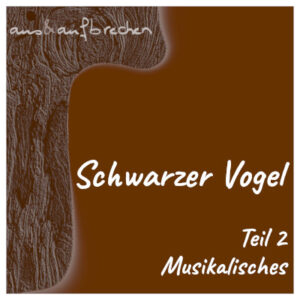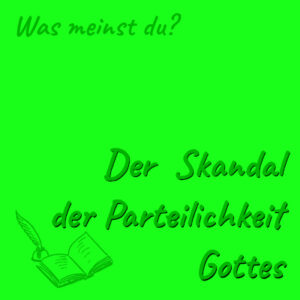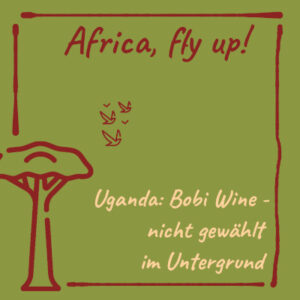Wenn in der psychosozialen Arbeit von Suizid gesprochen wird, richtet sich der Blick meist auf das Individuum: auf seine Lebensumstände, seine psychische Verfassung, seine Beziehungen. Aus dieser Perspektive entstehen Handlungsstrategien und Präventionskonzepte. Doch dieser Blick ist zu eng. Was, wenn nicht nur persönliche Krisen, sondern auch gesellschaftliche Entwicklungen Einfluss darauf haben, wie Menschen – vor allem Jugendliche – ihr Leben bewerten?
Ich möchte diesen Blick weiten. Denn wir leben in einer Gesellschaft, die zunehmend ein Klima erzeugt, in dem Suizid denkbarer, ja fast „verständlicher“ wird. Nicht, weil Menschen schwächer wären als früher, sondern weil unsere Werte sich verändern. Suizidfreundlichkeit entsteht aus einem tiefgreifenden Wandel unserer Haltungen.
Selbstbestimmung und Anpassung: vom Dürfen zum Müssen
Seit der Einführung des assistierten Suizids in Österreich 2022 hat der Wert der Selbstbestimmung eine neue Dimension erreicht. Wir wollen nicht nur entscheiden, wo und mit wem wir leben, sondern auch, wann und wie wir sterben. Diese Freiheit ist zweifellos Ausdruck von Autonomie, aber sie hat auch eine problematische Seite: Je mehr wir selbst bestimmen dürfen, desto größer wird der Druck, es auch zu müssen. Dieser „Selbstbestimmungsdruck“ trifft besonders junge Menschen, die in einer Welt voller Wahlmöglichkeiten permanent entscheiden sollen, wer sie sind, was sie werden, wie sie leben wollen.
Gleichzeitig bleibt der Anpassungsdruck bestehen: Wir sollen individuell, aber bitte normgerecht sein. Zwischen diesen beiden Polen – Selbstbestimmung und Anpassung – geraten viele in Überforderung und Verzweiflung.
Während früher Lebensschutz als höchste moralische Verpflichtung galt, hat sich dieser Wert heute verschoben. Heute steht nicht mehr das Leben an sich im Zentrum, sondern das lebenswerte Leben – ein Leben, das unseren Vorstellungen von Glück, Gesundheit und Erfolg entspricht. Was nicht lebenswert scheint, darf beendet werden. Der selbstbestimmte Tod wird zum Ideal.
Doch aus der Erlaubnis, sterben zu dürfen, wird leicht eine Aufforderung, sterben zu müssen – etwa dann, wenn Menschen sich als Belastung empfinden. Die gesellschaftliche Akzeptanz für den assistierten Suizid kann zur subtilen Erwartung werden, das eigene Leiden zu beenden, bevor es „zu viel kostet“ – finanziell, emotional, sozial.
Wir vergessen auf unsere Kinder!
Unsere Gesellschaft hat ihren Kindern über Jahrzehnte dieselbe Botschaft gegeben: „Euch soll es einmal besser gehen als uns.“ Doch dieses „besser“ wurde fast ausschließlich materiell verstanden. Es ging um Wohlstand, Eigentum, Konsum – nicht um Sinn, Nachhaltigkeit oder psychische Gesundheit. Heute zeigt sich, dass dieser Fortschrittsglaube seine Grenzen erreicht hat. Der materielle Wohlstand wuchs, doch die seelische Zufriedenheit schrumpfte.
Besonders bitter ist, dass wir in dieser Entwicklung eine Generation überspringen: Wir wollen die Welt enkel-, nicht kindertauglich machen. In politischen und gesellschaftlichen Diskursen wird oft von „Enkeltauglichkeit“ gesprochen – ein sympathischer Begriff, der aber verrät, dass die aktuelle Kinder- und Jugendgeneration bereits aufgegeben wurde. Wir versprechen eine bessere Welt für die Enkel, nicht für die eigenen Kinder. Sie erhalten diese Botschaft von einer Generation, die es schon längst besser machen hätte können. Ob unserezu kurz gekommenen Kinder noch Kinder haben möchten, für die die Welt tauglich ist, ist mehr als fraglich.
Kein Wunder, dass viele von ihnen zwischen Aktivismus und Resignation schwanken: Die einen kämpfen für Veränderung – für das Klima, für Gerechtigkeit –, die anderen ziehen sich ins Private zurück, schaffen sich kleine Inseln der Geborgenheit in einer Welt, die sie als feindlich erleben. Beide Strategien sind Reaktionen auf dieselbe Erfahrung: den Verlust von Zukunft.
Messen statt Maßhalten
Wir leben in einer Kultur, die alles misst: Leistung, Gesundheit, Schlaf, Glück. Zahlen bestimmen, was gut und richtig ist. Selbst die Lebensqualität wird in Statistiken übersetzt. Doch je mehr wir zählen, desto weniger spüren wir. Menschen werden zu Datensätzen, ihr Wert zu einer Zahl. Und wer sich in diesen Zahlen nicht wiederfindet, ist schnell bedeutungslos.
Dabei wollen wir doch alle dasselbe: nicht bloß leben, sondern lebenswert leben. Doch anstatt Bedingungen für ein solches Leben zu schaffen, definieren wir immer enger, was „lebenswert“ ist: jung, gesund, unabhängig, erfolgreich – und alles in Zahlen und Statistiken gegossen. Wer davon abweicht, gilt als defizitär. Der gesellschaftliche Diskurs über „Lebensqualität“ wird so zum Instrument der Ausgrenzung.
Diese Entwicklung hat eine ethische und emotionale Folge: Scham.
Wer den Normen nicht entspricht, erlebt Abwertung – durch andere und durch sich selbst. Hier entsteht ein gefährlicher Kreislauf: Gesellschaftliche Moralisierung verbirgt sich hinter dem Mantel vermeintlicher Toleranz. Wir nennen uns offen und inklusiv, doch diese Offenheit gilt nur, solange sich alle innerhalb der Grenzen der Mehrheitsmeinung bewegen. Wer anders denkt oder lebt, wird nicht nur kritisiert, sondern moralisch verurteilt.
Dieses paradoxe System produziert Scham und Schuldgefühle – und genau sie sind mächtige Treiber seelischer Krisen.
Auf sechs Punkte gebracht
Am Ende meines Beitrages habe ich sechs Punkte formuliert, die diese Dynamik zusammenfassen. Sie zeigen, wie gesellschaftliche Werte mit persönlicher Verzweiflung verknüpft sind – und wo wir ansetzen könnten, um das Klima wieder lebensfreundlicher zu machen:
Selbstbestimmungsdruck: Aus der Erlaubnis, selbst entscheiden zu dürfen, wird ein Zwang, alles selbst entscheiden zu müssen. Diese Überforderung kann zu suizidalen Krisen beitragen.
Anpassungsdruck: Trotz des Freiheitsideals fordert die Gesellschaft Konformität. Wer nicht „hineinpasst“, erlebt Ausgrenzung – auch körperlich, sozial und psychisch.
Moralisierte Toleranz: Wir preisen Vielfalt, aber nur, solange sie unseren moralischen Erwartungen entspricht. Wer abweicht, wird beschämt – und Scham ist eine der mächtigsten Quellen innerer Zerstörung.
Verlust des Lebenswerts: Wir wollen nicht bloß leben, sondern glücklich sein. Doch statt Bedingungen für Lebensfreude zu schaffen, akzeptieren wir, dass manche Leben „nicht mehr lebenswert“ sind.
Vergessen der Kinder: Das Versprechen, dass es „den Kindern besser gehen wird“, wurde auf Wohlstand reduziert – auf Kosten der nachfolgenden Generationen. Wir vergessen unsere Kinder, während wir die Welt für unsere Enkel „retten“ wollen.
Vermessung des Menschen: Aus Maßhalten wird Messen. Qualität wird in Quantität übersetzt, Glück in Zahlen. Der Mensch wird zum Zahlenwerk, ist berechenbar, verrechenbar und damit eintauschbar.
Keine Hoffnung machen
Wenn wir Jugendlichen Hoffnung geben wollen, dann nicht durch Parolen, sondern durch eine Haltung, die das Leben in seiner Zerbrechlichkeit bejaht. Wir leben in einer Kultur, die den Sinn verloren hat – und wer Jugendlichen einfach „Hoffnung machen“ will, ohne diesen Befund ernst zu nehmen, greift zu kurz. Hoffnung kann erst dort entstehen, wo man die Verzweiflung nicht verdrängt, sondern sie gemeinsam aushält.
Suizidprävention bedeutet mehr als Krisenintervention. Sie beginnt mit der Frage, welche Gesellschaft wir sein wollen: eine, die Leistung misst – oder eine, die Leben wertschätzt.
Vielleicht müssen wir wieder lernen, das einfache „Gut, dass du lebst“ – egal, wer oder was jemand ist – glaubwürdig sagen zu können.