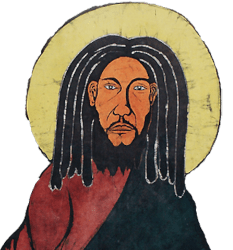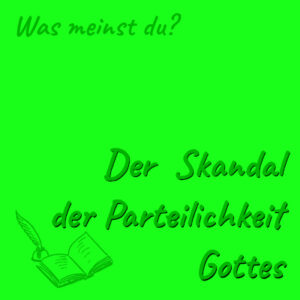Drei Folgen zum Thema Suizid habe ich bereits gemacht. Hier folgt ein
verspäteter Nachtrag. Die evangelische Kirche hat im Vergleich zur
katholischen einen völlig anderen Zugang. Der hat mich fasziniert
und über den möchte ich sprechen.
Hilfe in Krisen:
Telefonseelsorge Österreich: 142
Telefonseelsorge Deutschland: 0800 / 111 0 111 oder 0800 / 111 0 222
Die Dargebotene Hand Schweiz und Liechtenstein: 143
Diesen Podcast mache ich in meiner Freizeit. Wenn du diese Arbeit auch finanziell anerkennen möchtest, dann kannst du mich über ko-fi auf einen Tee einladen oder direkt über Paypal einen kleinen Betrag senden.
Transkript
Herzlich Willkommen zur 47. Episode meines Podcast „aus&aufbrechen“. Dem Podcast für eine offene und kritische christliche Spiritualität.
Im Jänner dieses Jahres habe ich drei Episoden zum Thema Suizid veröffentlicht. Es sind die Episoden 37 bis 39. Ich verlinke sie nochmals in den Shownotes.
Nachdem ich die Episoden hochgeladen habe, ist bei mir plötzlich die Frage aufgetaucht, warum ich die Sichtweise der evangelischen Kirche eigentlich nicht berücksichtigt habe. Das ist wohl meinem verengten katholischen Blick zu verdanken.
Ich habe mir also den evangelischen Erwachsenenkatechismus geschnappt und nachgelesen, was dort so zum Thema Suizid steht. Da hat mich einiges überrascht. Und davon möchte ich in dieser Episode erzählen. Ich trage also einen vierten Teil verspätet nach.
Ich werde dabei auch immer wieder auf die katholische Sichtweise zu sprechen kommen. Wenn du meine Episode dazu noch nicht gehört hast – es ist die 37. – empfehle ich dir, zuerst diese anzuhören. Du musst aber nicht. Ich glaube, du wirst dieser Episode dennoch folgen können.
Bevor es aber los geht, möchte ich auf folgendes hinweisen: Wenn du gerade in einer Krise bist oder sogar an Suizid denkst, überlege dir, ob du diese Episode weiterhören möchtest. In den Shownotes findest du Hilfsangebote.
Wenn du mit mir in Kontakt treten willst, kannst du das jederzeit auf diversen Kanälen tun. Dazu mehr Infos in den Shownotes. Ich freue mich auch über einen kleinen Obulus in meine Teekasse. Herzlichen Dank an alle, die da schon etwas hineingeworfen haben.
—
Was mir beim Blick in den Katechimus zuerst aufgefallen ist, ist die Einordnung des Themas Suizid. In der katholischen Lehre wird es in die Ethik eingeordnet. Der katholischen Kirche geht es vor allem um die Frage, ob der Suizid erlaubt sein soll oder nicht. Die evangelische Kirche ordnet dieses Thema in das siebente und letzte Kapitel ein, das mit „Ziel aller Wege. Ewiges Leben“ überschrieben ist. Sie verengt die Frage nach dem Suizid also nicht auf ein Problem der Ethik, sondern hat einen weiteren, religiösen und existenziellen Zugang zu diesem Thema.
Darüber hinaus wird im Text selbst deutlich, dass sehr stark seelsorglich gedacht wird. Diese Denkweise spielt zwar in der katholischen Kirche auch eine Rolle, nicht aber im Katechismus. Die Seelsorge kommt da gar nicht vor.
Indirekt gibt der evangelische Katechismus zu verstehen: Die ethische Bewertung des Suizides ist nicht das Kernproblem, sondern eingebettet in einen größeren Kontext, nämlich den der Seelsorge und der religiöse Sichtweise auf den Menschen, auf sein Leben und seinen Tod.
Ich möchte jetzt ein Zitat bringen, nämlich den ersten Absatz zum Thema Suizid, wie er im Evangelischen Erwachsenenkatechismus (S. 935 – 939) steht:
Es gehört zur Würde und Bürde des Menschen, nicht zwangsläufig existieren zu müssen. Zwar ist ihm das Leben wie allen Geschöpfen vorgegeben, und in der Regel bejaht er es und sucht es zu bewahren. Er ist jedoch nicht triebhaft an sein Leben gebunden, sondern kann und muss sich in Verantwortung und freier Entscheidung zu ihm verhalten.
Evangelischer Erwachsenenkatechismus, Seite 935
Diese wenigen Zeilen heben sich deutlich vom katholischen Menschenbild ab. Die katholische Kirche bestimmt das Leben als Geschenk Gottes und als sein Eigentum, dessen Verwalter der Mensch ist. Ich habe in der Folge dazu schon auf die Widersprüchlichkeit dieser Sichtweise hingewiesen.
Im Gegensatz dazu hält sich die evangelische Lehre in der Ambivalenz, obgleich sie es negativ ausdrückt: Nicht leben zu müssen, ist Würde und Bürde des Menschen. D. h. das Leben des Menschen ist dadurch gekennzeichnet, dass es nicht sein muss, sondern nur sein kann. Folge ist, dass der Mensch sich immer wieder für sein Leben entscheiden muss.
Der Katechimus weist auch darauf hin, dass Menschen oft viel bewusster leben, wenn sie in einer Krise an Suizid gedacht, den sie aber nicht ausgeführt haben. Sie haben sich bewusst für das Leben entschieden und haben damit ganz existenziell das Leben-Können und das Auch-nicht-leben-können, dieses Nicht-leben-müssen erfahren.
Aus dieser freien Entscheidung zum Leben erwächst auch die Verantwortung für dieses Leben. Allerdings wird nicht ausgeführt, was diese Verantwortung eigentlich umfasst. Welche ethischen Konsequenzen folgen aus dieser Verantwortung? Das bleibt zumindest an dieser Stelle unbeantwortet.
Sicherlich muss man hinzufügen, dass wir Menschen uns nicht tagtäglich beim Aufwachen bewusst für das Leben entscheiden. Der Absatz schreibt, dass uns das Leben vorgeben ist. Zunächst ist es vorgegeben. Niemand von uns hat sich für sein Dasein entschieden. Wenn wir uns entscheiden, dann immer nur für das Weiterleben.
Dieses Leben ist zunächst sogar wie selbstverständlich vorgegeben. Von Kindsein an hinterfragen wir unser Dasein zunächst nicht. Das kommt erst mit der Zeit und dann mit unterschiedlicher Intensität.
Je nach dem, wie sehr diese Selbstverständlichkeit hinterfragt wird, gilt daher grundsätzlich, dass wir das Leben normalerweise bejahen und es weiterführen wollen. Das evangelische Menschenbild lehnt es aber ab, von einem Lebenstrieb zu sprechen.
Wir erinnern uns an die katholische Sichtweise, die Thomas von Aquin zitiert: Sie meint, dass der Mensch eine natürliche Neigung zum Leben hat. Gemeint ist, dass es in der Natur des Menschen liegt, leben zu wollen. Und wenn die katholische Kirche von Natur spricht, dass kommt das, was die evangelische Kirche mit Trieb bezeichnet sehr nahe. Aber wie gesagt: Für den evangelischen Katechimus gibt es keinen Lebenstrieb.
Kurzum, um es einmal – aber nur einmal – mit theologischer Begrifflichkeit zu sagen: Während die katholische Kirche eine ontologische Anthropologie vertritt, geht die evangelische Kirche empirisch, erfahrungsbezogen vor. Dabei hält letztere das Menschenbild sehr in Ambivalenz, während die katholische Kirche eindeutiger ist und daher zu klareren Folgerungen kommt. Allerdings ist die katholische Ontologie für heutige Menschen nicht mehr nachvollziehbar.
Daher geht der evangelische Katechismus nach diesem zitierten Absatz einen ganz anderen Weg als sein katholisches Pendant. Er kommt jetzt auf die verschiedene Ergebnisse der Suizidforschung zu sprechen. Dabei distanziert er sich auch vom Begriff „Selbstmord“, der ja von Martin Luther stammt.
Anschließend wird kurz über den biblischen Befund gesprochen, auf den ich ausführlich in der 38. Episode eingegangen bin. Schließlich werden noch ein paar Stationen der Theologiegeschichte geschildert, unter anderem die Positionen Martin Luthers und Karl Barths.
Dabei fällt mir folgendes auf:
Der Katechimus spricht keine Verurteilung des Suizides aus, befürwortet ihn aber auch nicht explizit. Mit anderen Worten: Es gibt keine klare ethische Bewertung des Suizides. Allenfalls kann man indirekt eine Bewertung herauslesen.
Der Punkt ist nämlich, dass dem Katechismus die seelsorgliche Begleitung eines Betroffenen wichtiger ist, als die ethische Bewertung. Die seelsorgliche Begleitung soll das Ziel haben, den Suizidenten wieder zu einem neuen Leben zu verhelfen, zu einer „Auferstehung mitten im Leben“, wie es ausdrücklich heißt. Indirekt kann man daraus also schließen, dass der Suizid zu vermeiden ist.
Die Enthaltung eines Urteils und die ethische Ambivalenz der evangelischen Kirche ergibt sich aus den vielfältigen Ursachen und Kontexten von Suizidalität, die eine einheitliche Beurteilung erschweren. Dennoch spricht auch der Katechismus immer von dem Suizid, also so als ob es nur eine Art gäbe. Das habe ich schon in den anderen Episoden kritisiert.
Ausdrücklich wird betont, dass es zu keiner Ungleichbehandlung von Suizidenten in Hinblick auf das Begräbnis kommen darf, wie es auch in der evangelischen Kirche früher einmal der Fall war. Mit der katholischen Kirche stimmt die evangelische überein, dass Gott auch die Suizidenten nicht verdammen, sondern für sie Wege des Heiles eröffnen wird.
Diese unterschiedlichen Zugangsweisen haben auch ganz praktische Konsequenzen. Als vor wenigen Jahre in Österreich der assistierte Suizid zugelassen wurde, hat die katholische Caritas anders darauf reagiert als die evangelische Diakonie. Während die Caritas diese Möglichkeit in ihren Heimen nicht zulässt, hält die evangelische Kirche sich in der Ambivalenz. Beides hat seine Vorteile:
In einem Pflegeheim der Caritas kann ich mir sicher sein, zu keinem Suizid – direkt oder indirekt – gedrängt zu werden. Vielmehr ist klar, dass es solches hier nicht gibt. Ich kann ohne – realen oder eingebildeten – Druck dem Lebensende entgegengehen.
In den Pflegeheimen der Diakonie wird die Not der Menschen im Leiden gesehen. Und es wird als unmenschlich betrachtet, dass jemand aus dem Heim ausziehen müsste, wenn er den assistierten Suizid in Anspruch nehmen wollen würde, und damit nicht mehr in seiner vertrauten Umgebung sterben dürfte.
Zum Abschluss möchte ich mit einem Zitat aus dem evangelischen Katechismus schließen, in dem auf die Lehre des Theologen Karl Barth Bezug genommen wird.
Er spricht vom Suizid als eine
im Glauben unmögliche Möglichkeit des Menschen. Glauben und Todeshang stehen sich wie Leben und Tod gegenüber. Und doch können Gottes Wege den Menschen auch in und durch diesen Tod hindurch begleiten. […] Die durch Jesus Christus offenbar gewordene Liebe Gottes kann dem Angefochtenen zeigen, dass ihn nichts trennen kann von dieser Liebe (Röm 8,38f.) und dass auch Scham, Schuld und andere scheinbar unüberwindliche Sackgassen im Leben, die zu Todesmächten werden können, von der göttlichen Vergebung relativiert und entmachtet werden.
Evangelischer Erwachsenenkatechismus, Seite 939