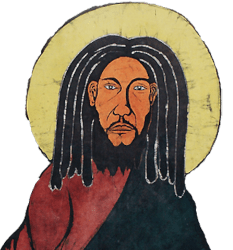„Die Fürsten aus Ägypten kommen;
Kusch streckt eilends seine Hände aus zu Gott.“
(Psalm 68, Vers 32)
Hallo,
endlich gibt es mal einige gute Nachrichten aus Afrika. Aber vorher noch ein Wort zum Bibelvers am Beginn dieses Newsletters. Er ist ein Teil einer heilbringenden Endzeitvision, in der zwei afrikanische Länder genannt werden: Ägypten und Kusch. Letzteres umfasste wahrscheinlich das heutige Sudan und Äthiopien.
In der Bibel wird noch ein drittes afrikanisches Land erwähnt, nämlich Put, das vermutlich im heutigen Libyen gelegen ist.
Aber zurück zum heutigen Afrika:
- In Namibia wurde zum ersten Mal eine Frau zur Präsidentin gewählt.
- In der Sahel-Zone setzt man die Errichtung einer Grünen Mauer um. Und du kannst helfen, ohne zu spenden.
- In Mosambik verwendet man keine Schimpfwörter.
- In Kenia lehnt die Kirche Spendengelder von Politikern ab.
- Und in Kamerun erhalten Frauen endlich eine Geburtsurkunde. Damit eröffnet sich ihnen eine neue Welt.
Natürlich gibt es nicht nur gute Nachrichten. Leider scheint für die neue Regierung Religion keine gesellschaftlich relevante Ressource zu sein. Vielmehr wird sie überwiegend als Potenzial der Gefährdung gesehen.
aus&aufbrechen
Der Podcast für eine offene und kritische christliche Spiritualität

… schaust du zurück …
Ein Beter betet aus der Erfahrung der Abwesenheit Gottes. Gott bliebt abwesend. Er antwortet nicht. Dem Beter bleibt nur der Blick in die Vergangenheit. Interpretation zu Psalm 77.

… und vermisst Gott …
Wer vermisst Gott eigentlich? Ist denn Gott abwesend? Der neueste Atheismus ist sich der Leerstelle bewusst, die ein abwesender Gott hinterlässt. Er wird vermisst. Und doch hat Gott gesagt, dass er einmal kommen wird. Nur wann?
ziellos unterwegs
Der Pilger-Blog
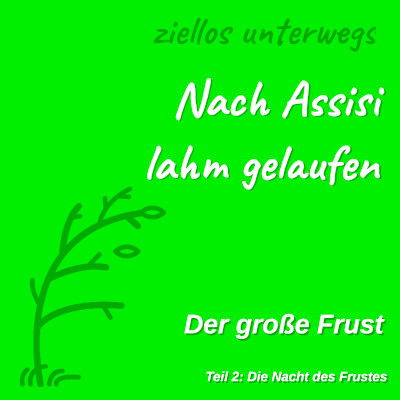
Der Nacht des Frustes
Mit schlechtem Ladekabel, wenig Akku und ohne Läden in Sicht lag ich in der Natur. Blinken, Schritte, Lärm vom Pfarrfest – Schlaf unmöglich. Genervt zog ich ins Dorf, trank Bier, beobachtete Karaoke und Trommler. Später schlief ich am Bahnhof. Um 5 Uhr setzte ich meinen nächtlichen Entschluss um.

Das endgültige Aus
Nach einer schlaflosen Nacht beschloss ich, die Wanderung abzubrechen. In Foligno kaufte ich ein Ladekabel, dann in Matigge ein Zelt. Zu Fuß zurück, mit Zug und Bus nach Assisi, gönnte mir ein Hotelzimmer und zog auf den Campingplatz. Die Reise lief anders als geplant. Doch sie zeigte mir meine Grenzen und ließ mich reflektieren.
Was meinst du?
Der Schreib-Blog
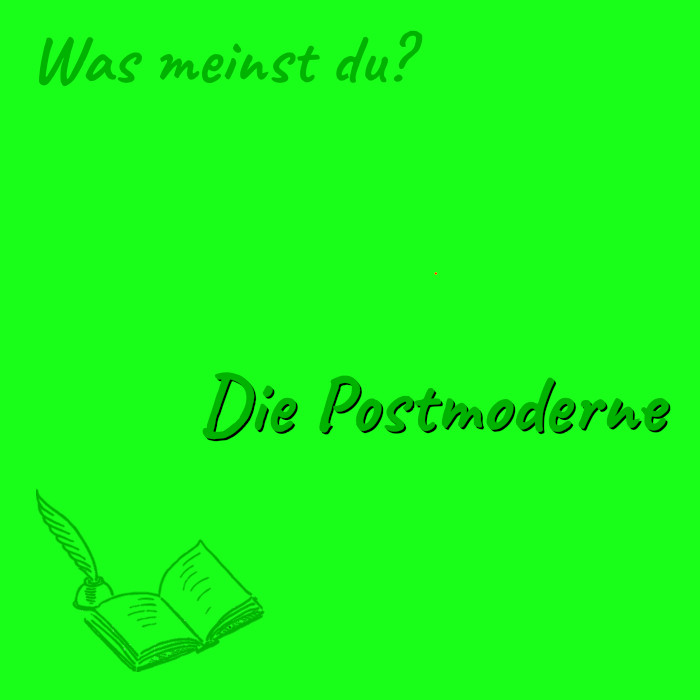
Die Postmoderne
In den letzten zwei Wochen habe ich ein Skriptum zum Thema „Sozialphilosophie und Soziologie“ geschrieben. Hier ein Ausschnitt über das Thema Postmoderne.
Was lest ihr heraus? Wie versteht ihr den Text?
Wissenswertes aus der Christenheit
Regierungsprogramm:
Religion als Gefahr, nicht als Chance
So wie in der Überschrift steht es nicht explizit im frisch vorgestellten Regierungsprogramm der neuen österreichischen Bundesregierun. Liest man dieses aber durch und beachtet man auch, worüber nicht gesprochen wird, zeigt sich ein einseitig negatives Bild von Religion.
Einerseits erscheint Religion vorwiegend im Zusammenhang mit Sicherheitspolitik, insbesondere in der Diskussion um den „politischen Islam“; andererseits fehlen umfassende Aussagen zu Religionsgemeinschaften, Glaubenspraxis oder kirchlicher Mitverantwortung im gesellschaftlichen Leben.
Religion als Risiko: Der politische Islam im Fokus
Mehrfach nimmt das Programm Bezug auf den sogenannten politischen Islam, der als Bedrohung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die demokratische Ordnung beschrieben wird. Die Regierung kündigt an, die bereits bestehende Dokumentationsstelle zum politischen Islam weiter auszubauen und gesetzliche Verschärfungen zu prüfen. Explizit wird erwähnt, dass sich die islamische Religionspädagogik an der Verfassung und den Menschenrechten zu orientieren habe. Begriffe wie „religiös motivierter Extremismus“ tauchen in sicherheitspolitischen Kapiteln auf – ein deutliches Signal, dass Religion primär als potenzielles Sicherheitsrisiko thematisiert wird.
Zudem wendet sich das Regierungsprogramm ausdrücklich gegen religiös motivierte Homophobie und einen ebensolchen Antisemitismus.
Religiöse Institutionen werden in diesem Zusammenhang als Partner in der Bekämpfung des Extremismus gesehen. Interreligiöse Begegnungen sollen gefördert werden. Was hingegen fehlt, ist eine differenzierte Auseinandersetzung mit religiösem Leben abseits sicherheitspolitischer Perspektiven.
Werte ja – Religion nein?
Das Wort „Religion“ selbst findet sich im gesamten Dokument lediglich in wenigen Kontexten. So betont die Koalition etwa die Bedeutung von „unseren Werten“ und „gesellschaftlichem Zusammenhalt“ „in einer pluralistischen Gesellschaft“, ohne diese jedoch explizit religiös zu unterfüttern. Der Glaube als persönliche oder gesellschaftliche Ressource bleibt unerwähnt.
Kirchliche Institutionen oder Religionsgemeinschaften als Partner in der Sozialarbeit, im Bildungsbereich oder bei ethischen Debatten werden nicht direkt adressiert.
Kein Wort zu Kirchenfinanzierung oder Islamgesetz
Auffällig ist, was fehlt: Kein einziger Absatz widmet sich der Finanzierung von Religionsgemeinschaften oder dem teils heftig diskutierten Islamgesetz. Auch Debatten rund um Kreuze in öffentlichen Räumen oder Gebetsräume in Schulen, die in früheren Jahren wiederholt politische Schlagzeilen machten, finden keinen Platz.
Aber ein kleiner Absatz widmet sich dem „Kopftuch“, dessen Tragen in der Pflichtschule mittlerweile verboten ist. Die Regierung sieht das als Maßnahme zur Stärkung weiblicher Selbstbestimmung und zum Schutz vor Unterdrückung Minderjähriger.
Einsatz für Menschenrechte im Ausland
Die Christen werden nur an einer kleinen Stelle erwähnt, nämlich da, wo sich die Regierung für den Schutz von Minderheiten aller Art, für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit im Ausland einsetzen will.
Während frühere Programme regelmäßig kirchliche Partner hervorhoben oder klare Positionen zum Religionsrecht einnahmen, wirkt das neue Regierungsprogramm beinahe entkernt in Bezug auf Glaubensfragen. In einer Zeit, in der Polarisierung und kulturelle Debatten an Fahrt aufnehmen, überrascht es, dass die Zusammenarbeit von Religionen und nicht-religiösen Weltanschauungen mit anderen gesellschaftlichen Akteuren so unterbelichtet bleibt..
Christlicher Nationalismus in den USA
An dieser Stelle wurde schon öfter über die Nähe von Donald Trump, den religiösen Rechten und den evangelikalen Christen geprochen. Hier nun ein Podcast, der sehr detailliert und vor allem unterhaltsam über den christlichen Nationalismus in den USA informiert, der auch vor Europa nicht halt macht. Immerhin werden auch Sebastian Kurz und die ÖVP erwähnt.
Theologe Halik kauft Kloster in Mittelböhmen
Der renommierte Theologe und Soziologe Tomáš Halík hat das Kapuzinerkloster in Kolín erworben, um dessen Zukunft als Zentrum für Spiritualität und Exerzitien langfristig zu sichern. Das Gebäude und das dazugehörige Grundstück überließ er ablöse- und zinsfrei dem von ihm unterstützten Institut „Kolínský Klášter“, das nun für den Betrieb und das geistliche Programm verantwortlich ist. Damit setzt Halík ein starkes Zeichen für den Erhalt spiritueller Stätten und die Förderung religiöser Bildung in Tschechien.
Das Kloster hat eine bewegte Geschichte: Nach der Enteignung durch den kommunistischen Staat erhielten die Kapuziner es nach der Samtenen Revolution 1989 zurück. 1992 wurde es den Jesuiten zur Nutzung überlassen, die dort das Noviziat ihrer böhmischen Provinz einrichteten. Später wurde es als Exerzitienhaus genutzt, bis die Kapuziner 2018 den Verkauf beschlossen. Da die Jesuiten den Kauf nicht finanzieren konnten, wurde das Kloster an das Institut „Kolínský Klášter“ vermietet, das aus der „Tschechischen Christlichen Akademie“ hervorgegangen war. Seit 2014 unterstützt Halík die Arbeit dieses Instituts finanziell.
Halík selbst ist eine herausragende Persönlichkeit der katholischen Intellektuellenszene. Während des Kalten Kriegs wurde er im Untergrund zum Priester geweiht und spielte eine bedeutende Rolle im kirchlichen und gesellschaftlichen Leben nach der politischen Wende in Tschechien. Seit 1990 präsidiert er die „Tschechische Christliche Akademie“ und hat zahlreiche wissenschaftliche und theologische Werke veröffentlicht. 2014 wurde ihm der Templeton-Preis verliehen, den er als finanzielles Fundament für den Klostererwerb nutzte. Mit dem Kauf sichert Halík nicht nur ein Stück religiöses Erbe, sondern schafft auch einen Ort der Einkehr und geistlichen Vertiefung für künftige Generationen.
Ordensspitäler recyceln Narkosegase
Immer mehr Ordensspitäler in Österreich setzen auf Nachhaltigkeit, um ihren klimaschädlichen Ausstoß zu senken. Aktuell gewinnt besonders das Recycling von Narkosegasen an Bedeutung, da diese bisher ungenutzt in die Atmosphäre gelangten. Narkosegase wie Desfluran oder Sevofluran sind extrem klimaschädlich – ihr Treibhauspotenzial ist tausendfach höher als das von CO₂. Mithilfe moderner Technologien werden die Gase nun aufgefangen, aufbereitet und wiederverwendet. Dies trägt nicht nur zur Reduktion der Umweltbelastung bei, sondern spart auch Ressourcen und Kosten – ein wichtiger Schritt für eine klimafreundlichere Medizin.
Brennpunkt Afrika
Netumbo Nandi-Ndaitwah:
Namibias erste Präsidentin
Am 21. März 2025 wurde Netumbo Nandi-Ndaitwah als erste Frau in der Geschichte Namibias zur Präsidentin vereidigt. Die Zeremonie fiel mit dem 35. Jahrestag der Unabhängigkeit des Landes zusammen und markierte einen bedeutenden Meilenstein für die Nation.

Politische Laufbahn und Wahlerfolg
Nandi-Ndaitwah, 72 Jahre alt und langjähriges Mitglied der South West Africa People’s Organization (SWAPO), bekleidete zuvor Positionen als Außenministerin und Vizepräsidentin. Nach dem Tod von Präsident Hage Geingob übernahm sie die Führung des Landes. Bei den Wahlen im November 2024 gewann sie mit 57 % der Stimmen und setzte sich gegen ihren Hauptkonkurrenten Panduleni Itula durch, der 25 % erhielt. Trotz des Wahlsiegs musste SWAPO Verluste hinnehmen und verfügt nun über eine reduzierte, aber absolute Mehrheit im Parlament.
Wirtschaftliche Herausforderungen und Reformpläne
Namibia steht vor erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen, darunter eine stagnierende Wirtschaft, hohe Arbeitslosigkeit und erhebliche soziale Ungleichheiten. In ihrer Antrittsrede betonte Nandi-Ndaitwah ihr Engagement für gute Regierungsführung und regionale Zusammenarbeit. Sie versprach, wirtschaftliche Reformen einzuleiten, insbesondere in den Bereichen Bergbau, Tourismus und Landwirtschaft, um Arbeitsplätze zu schaffen und ausländische Investitionen anzuziehen.
Potenzial durch Energieentdeckungen
Die jüngsten Offshore-Öl- und Gasfunde bieten Namibia die Chance, sein jährliches BIP-Wachstum innerhalb eines Jahrzehnts auf 8 % zu verdoppeln. Die Regierung plant, die Produktion bis 2027 zu beschleunigen, um die Abhängigkeit von Diamanten zu verringern und die Wirtschaft zu diversifizieren. Allerdings ist die effektive Verwaltung dieser Ressourcen entscheidend, um die Fehler anderer rohstoffreicher Länder zu vermeiden.
Blick in die Zukunft
Als erste weibliche Präsidentin Namibias steht Nandi-Ndaitwah vor der Aufgabe, das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung zu stärken und die versprochenen Reformen umzusetzen. Ihr Erfolg wird maßgeblich davon abhängen, wie effektiv sie die wirtschaftlichen Herausforderungen bewältigt und ob sie die Lebensbedingungen der Bürger nachhaltig verbessern kann.
Sahel: Grüne Mauer in der Wüste
In einer der klimatisch und politisch schwierigsten Regionen der Welt wächst eine Vision heran, die Hoffnung spendet: die „Grüne Mauer“. Dieses ambitionierte Projekt will die fortschreitende Wüstenbildung in der Sahelzone eindämmen – durch großflächige Aufforstung, nachhaltige Landwirtschaft und das aktive Engagement der lokalen Bevölkerung.
Ein grüner Gürtel gegen die Wüste
Die Sahelzone, ein Übergangsgebiet zwischen der Sahara im Norden und den Savannen im Süden, leidet massiv unter Umweltzerstörung, Dürre, Überweidung und dem Verlust von Artenvielfalt. Die Region erstreckt sich über mehrere Länder – von Senegal über Mali und Niger bis in den Sudan.
Doch die Herausforderungen sind nicht nur ökologischer Natur: Viele Teile der Sahelzone werden zunehmend von terroristischen Gruppen destabilisiert. Vor allem islamistische Milizen nutzen schwache staatliche Strukturen aus, kontrollieren ganze Gebiete und behindern damit Entwicklungsprojekte wie die Grüne Mauer erheblich. In einigen Regionen ist es zu gefährlich, Aufforstungsmaßnahmen überhaupt zu beginnen.
Hinzu kommt ein akuter Finanzierungsengpass. Zwar hatten internationale Geberländer ursprünglich zugesagt, rund 19 Milliarden US-Dollar bis 2030 bereitzustellen. Doch bisher wurde ein großer Teil dieser Summe nicht ausgezahlt oder durch andere geopolitische Krisen wie den Ukrainekrieg und innenpolitische Sparprogramme umgeleitet. Viele Initiativen, besonders in ländlichen Gebieten, müssen deshalb mit unzureichenden Mitteln arbeiten.
Ecosia und lokale Partner treiben Aufforstung voran
Trotz dieser Rückschläge gibt es bemerkenswerte Fortschritte. Die ökologische Suchmaschine Ecosia etwa hat seit 2018 mehr als 17 Millionen Bäume auf rund 6.000 Hektar im Senegal pflanzen lassen. Die Einnahmen aus Suchanfragen und Werbeklicks fließen direkt in Aufforstungsprojekte. „Durch Bäume sichern wir Ernährung, schaffen Einkommen und stärken die Widerstandsfähigkeit der Gemeinden“, so Ecosia auf seiner Website. Das Besondere: Die lokale Bevölkerung wird intensiv einbezogen – vom Pflanzen der Setzlinge bis zur Pflege der jungen Bäume.
Jeder Klick zählt
Das Besondere: Über die Einnahmen aus Suchanfragen und Klicks auf Werbeanzeigen finanziert Ecosia seine Aufforstungsprojekte. Damit kann jeder Internetnutzer einen kleinen Beitrag leisten – ganz ohne Spende, allein durch die Wahl der Suchmaschine.
Hier zu Ecosia, der Suchmaschine, die Bäume pflanzt.
Was Bäume bewirken
Die Pflanzung von Bäumen bringt eine Vielzahl ökologischer Vorteile mit sich. Sie stabilisieren den Boden durch ihre Wurzeln und schützen ihn so vor Erosion – ein entscheidender Faktor in einer Region, in der fruchtbarer Boden zur Mangelware wird. Durch den Schatten und die Verdunstung sorgen Bäume zudem für ein lokales Mikroklima, das Temperaturen senkt und die Wasserspeicherung im Boden verbessert. Darüber hinaus absorbieren sie CO₂ aus der Atmosphäre und leisten so einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel. Die wachsende Vegetation schafft Lebensräume für Tiere und Pflanzen und erhöht die Biodiversität. Nicht zuletzt verbessern Bäume die Grundwasserneubildung, was langfristig auch der Landwirtschaft zugutekommt.
Ein Projekt mit globaler Bedeutung
Die Grüne Mauer ist weit mehr als ein Umweltprojekt – sie ist ein Symbol für nachhaltige Entwicklung, Selbstbestimmung und internationale Zusammenarbeit. Trotz bewaffneter Konflikte, politischer Instabilität und fehlender Gelder setzen sich Millionen Menschen in der Sahelzone für eine lebenswerte Zukunft ein. Und sie zeigen: Selbst unter widrigsten Bedingungen kann Hoffnung wachsen – Baum für Baum.
Mosambik: Wahlbetrug und Unruhen, aber keine Schimpfwörter
Mosambik, ein Land an der südostafrikanischen Küste, ist bekannt für die Herzlichkeit und Gastfreundschaft seiner Bevölkerung. Die Mosambikaner empfangen Besucher mit offenen Armen und zeigen eine bemerkenswerte Freundlichkeit. Schimpfwörter sind ihnen fremd.
Der Podcast „Mosambik: Stabilität durch Wahlbetrug“ von Julian Hilgers beleuchtet die politischen Entwicklungen des Landes und diskutiert, wie Wahlmanipulationen zur scheinbaren Stabilität beitragen können. Bei den allgemeinen Wahlen am 9. Oktober 2024 wurde Daniel Chapo, der Kandidat der Regierungspartei FRELIMO, mit 70,67 Prozent der Stimmen zum Präsidenten erklärt. Der unabhängige Kandidat Venâncio Mondlane, unterstützt von der Optimistischen Partei für die Entwicklung Mosambiks (PODEMOS), erhob jedoch Vorwürfe des Wahlbetrugs und erklärte sich selbst zum Präsidenten.
Diese umstrittenen Wahlergebnisse führten zu landesweiten Protesten und Unruhen. In der Hauptstadt Maputo und anderen Städten kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, bei denen Demonstranten Gebäude und Fahrzeuge in Brand setzten. Die Sicherheitskräfte reagierten mit Gewalt, was zu zahlreichen Todesfällen und Verletzten führte. Berichte sprechen von mindestens 21 Toten und über 200 schweren Straftaten innerhalb von 24 Stunden nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses.
Die mosambikanische Bevölkerung reagierte gespalten auf die Ereignisse. Während Anhänger der Opposition ihren Unmut auf den Straßen ausdrückten, riefen andere zur Ruhe und Besonnenheit auf. Internationale Organisationen und Menschenrechtsgruppen forderten die Regierung auf, die Berichte über Menschenrechtsverletzungen während der Proteste zu untersuchen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
Die Diskussion über die Balance zwischen politischer Stabilität und demokratischer Integrität bleibt in Mosambik aktuell. Es ist entscheidend, dass transparente und faire Wahlprozesse gefördert werden, um das Vertrauen der Bevölkerung in die politischen Institutionen wiederherzustellen und eine nachhaltige, gerechte politische Landschaft zu schaffen.
Folgender Podcast kann in jedem Podcast-Catcher (Spotify, Apple Podcast …) angehört werden.
Kenia: Kirche lehnt Politiker-Gelder ab
In Kenia wächst die Kritik an der weit verbreiteten Praxis, dass Politiker große Geldsummen an Kirchen spenden. Vor dem Hintergrund einer angespannten Wirtschaftslage – mit unterfinanzierten Schulen, fehlenden Medikamenten in Krankenhäusern und unbezahltem Personal – fragen sich viele, woher diese Gelder stammen und welchem Zweck sie dienen.
Kirchliche Reaktionen: Zwischen Ablehnung und Appell
Bischof Cleophas Oseso von Nakuru sprach sich in seiner Aschermittwochspredigt deutlich gegen die Spendenpraxis aus: „Wir lassen nicht zu, dass die Kirche als Nutznießer gesehen wird, solange es in den Schulen keine Bücher und in den Krankenhäusern keine Medikamente gibt.“ Er stellte auch die Herkunft der Gelder infrage: „Wir wissen nicht, woher die riesigen Geldsummen kommen.“
Zugleich erinnerte Oseso an biblische Prinzipien diskreter Wohltätigkeit: „Spenden müssen im Geheimen erfolgen, um sicherzustellen, dass sie echt sind und nicht als Wahlkampfmittel dienen.“
Auch die Erzdiözese Nairobi hat sich positioniert: Erzbischof Philip Arnold Subira Anyolo kündigte an, Spenden von Politikern zurückzuweisen: „Diese Gelder werden an die jeweiligen Spender zurückgegeben.“ Die Kirche wolle sich unabhängig und integer gegenüber politischem Einfluss zeigen.
Politiker verteidigen ihre Spenden
Einige Politiker rechtfertigen ihre Gaben als Ausdruck ihres Glaubens und ihrer Solidarität mit der Bevölkerung. Sie betonen, dass ihre Beiträge kirchliche Bauprojekte oder soziale Dienste finanzieren – Maßnahmen, die der Gemeinschaft zugutekämen.
Viele Kenianer hingegen betrachten die Spenden skeptisch. Sie befürchten, dass sie vor allem dazu dienen, politische Unterstützung zu erkaufen oder von Missständen abzulenken.
Politische und wirtschaftliche Spannungen im Hintergrund
Die Diskussion fällt in eine Zeit sozialer Unruhe: Ein neues Finanzgesetz, das Steuererhöhungen vorsieht, hat landesweite Proteste ausgelöst. Die Maßnahmen sollen zusätzliche Einnahmen zur Begleichung der Auslandsschulden bringen, führen jedoch zu steigenden Lebenshaltungskosten.
Vor allem junge Menschen, die die Proteste tragen, fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Erzbischof Anthony Muheri von Nyeri erklärte: „Junge Menschen können nicht mehr atmen.“ Er forderte die Regierung auf, Alternativen zur Steuerlast zu finden. Gleichzeitig rief Erzbischof Muhatia Makumba aus Kisumu zu friedlichen Demonstrationen auf und appellierte an den Respekt für das Demonstrationsrecht.
Präsident William Ruto verteidigte das Gesetz und bezeichnete die Proteste als „verräterisch“. Trotz einzelner Zugeständnisse – etwa beim Wegfall von Steuern auf Grundnahrungsmittel – hält die Regierung an der Gesetzesreform fest.
Geburtsurkunden für Frauen in Kamerun:
Ein Kampf um Rechte und Identität
In Kamerun ist eine Geburtsurkunde weit mehr als nur ein amtliches Dokument. Sie ist der Schlüssel zu Bildung, Gesundheitsversorgung und bürgerlichen Rechten. Doch für viele Frauen in ländlichen Regionen bleibt dieser Schlüssel unerreichbar. Tausende von ihnen besitzen keine offiziellen Papiere – sie sind für den Staat unsichtbar.
Die Gründe dafür sind vielfältig. In abgelegenen Dörfern gibt es oft keine Registrierungsstellen. Viele Geburten finden zu Hause statt, fernab staatlicher Strukturen. In einigen Fällen wissen die Betroffenen nicht einmal, dass sie eine Geburtsurkunde benötigen. Und selbst wenn das Bewusstsein vorhanden ist, scheitert der Zugang häufig an den hohen Kosten und komplizierten Verfahren für eine nachträgliche Registrierung. Besonders betroffen sind Frauen aus armen Verhältnissen, für die der bürokratische Aufwand und die finanziellen Hürden kaum zu bewältigen sind.
Die Folgen dieser Unsichtbarkeit sind gravierend. Ohne Geburtsurkunde haben Frauen keinen Zugang zu Schulbildung, können keine Arbeit im formellen Sektor aufnehmen und bleiben von staatlichen Leistungen ausgeschlossen. Der fehlende Identitätsnachweis bedeutet in vielen Fällen auch: kein Recht auf Schutz. Für Opfer von Gewalt oder Zwangsehen ist das besonders dramatisch.
Fatima, eine 34-jährige Frau aus dem Norden Kameruns, schildert ihre Geschichte: „Ich wurde mit 16 zwangsverheiratet, konnte mich aber nie offiziell scheiden lassen, weil ich keine Geburtsurkunde habe. Ich existiere für den Staat nicht, also habe ich keine Rechte.“ Ohne offizielle Dokumente ist es ihr bis heute nicht möglich, ein Konto zu eröffnen, staatliche Hilfe zu beantragen oder auch nur einen Mietvertrag abzuschließen.
Um diese Situation zu verbessern, wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Initiativen ins Leben gerufen. Eine Bürgermeisterin ließ kürzlich über 300 Frauen und Kindern Geburtsurkunden ausstellen – unterstützt von Organisationen wie UN Women. In Gemeinden wie Ntui und Yoko wurden dadurch bereits hunderte Menschen registriert. Auch die kamerunische Regierung hat erkannt, wie dringlich das Problem ist: In Kooperation mit der Organisation La Francophonie soll zwischen 2024 und 2027 ein landesweites Programm 500.000 Geburtsurkunden ausstellen.
Doch trotz dieser Fortschritte bleibt Kritik an der Umsetzung nicht aus. Die nachträgliche Ausstellung einer Geburtsurkunde ist oft teuer, vor allem wenn eine gerichtliche Bestätigung nötig ist. In vielen Regionen fehlt es zudem an gut erreichbaren Registrierungsstellen. Frauen müssen weite Strecken zurücklegen – was Zeit, Geld und in manchen Fällen auch Sicherheit kostet. Außerdem orientiert sich die kamerunische Verwaltung stark an westlichen Modellen, ohne die spezifischen Bedingungen im Land ausreichend zu berücksichtigen. Viele Frauen, vor allem in ländlichen Gebieten, sind nicht alphabetisiert und stoßen an ihre Grenzen, wenn es um das Ausfüllen von Formularen oder das Verständnis bürokratischer Abläufe geht.
Dabei wäre die Lösung eigentlich einfach: Ein vereinfachtes, dezentrales System zur Geburtenregistrierung, das kostengünstig, verständlich und an die Lebensrealitäten der Menschen angepasst ist. Die Anerkennung jedes Individuums beginnt mit einem Dokument – aber dahinter steht das Recht auf eine selbstbestimmte Zukunft.
Wenn du diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, kannst du dich hier abmelden.