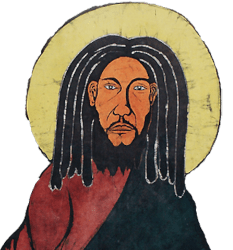„Ich denke an die Taten des HERRN, ja, ich will denken an deine früheren Wunder.“
(Psalm 77, Vers 12)
Altes soll weiterleben.
In heutigen Zeiten scheint das auf verschiedenen Wegen denkbar zu sein. So wurde aus den Weisheiten des spirituellen Lehrers David Steindl-Rast ein Chatbot geschaffen, der über den Tod des Mönchs hinaus Menschen in ihrer spirituellen Suche helfen soll.
Da mutet die Lehre von der Wiedergeburt „Old-School“ an. Der Dalai Lama meint zwar, noch 20 Jahre zu leben, glaubt aber auch, dass er wiedergeboren wird – in einem freien Land. Die chinesische Regierung ist da anderer Meinung.
Ist das Christentum dem allen gegenüber nicht eine Lehre, dass Neues anbricht und das Alte vergangen ist? Oder ist Gegenüberstellung von alt und neu verkürzt? Lehrt das Christentum nicht vielmehr, dass das Neue und der Neuaufbruch von Alters her zu bewahren ist?
Darüber hinaus wirft dieser Newsletter noch einen Blick nach Japan und Nigeria. Und ins Stift Heiligenkreuz.
Hinweis: Im August erscheint kein Newsletter.
aus&aufbrechen
Der Podcast für eine offene und kritische christliche Spiritualität
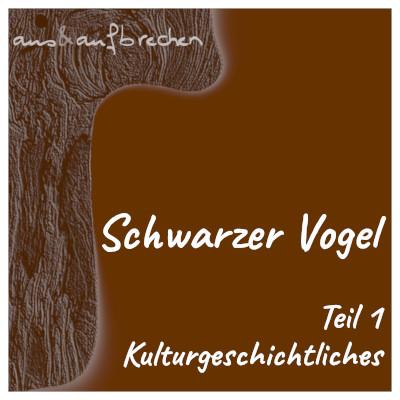
Schwarzer Vogel: Kulturgeschichtliches
Raben, Krähen und andere schwarze Vögel gelten oft als düstere Omen – doch das ist nur die halbe Wahrheit. In dieser Episode tauche ich ein in die symbolische Bedeutung schwarzer Vögel in der Bibel, alten Märchen und der Kulturgeschichte. Was hat es mit Noahs Raben auf sich? Warum werden Brüder in Raben verwandelt? Und was hat Odin mit all dem zu tun? Eine spannende Reise durch dunkle Federn und tiefere Bedeutungen.

Schwarzer Vogel: Musikalisches
Drei Songs, drei Bedeutungen: Vom Freiheitsruf der Beatles bis zur Todessehnsucht bei Ludwig Hirsch – in dieser Folge wird der schwarze Vogel musikalisch. Was sagt sein Gesang über uns aus?
Zum Podcast
Wissenswertes aus der Christenheit
Apostolische Visitation im Stift Heiligenkreuz
Das traditionsreiche Zisterzienserstift Heiligenkreuz steht vor einer bedeutenden kirchlichen Prüfung: Im Juni 2025 kündigte der Vatikan eine Apostolische Visitation an. Ziel ist es, ein umfassendes Bild von der geistlichen, strukturellen und personellen Lage des Klosters zu gewinnen.
Die Maßnahme wurde vom Dikasterium für das geweihte Leben in Rom angeordnet. Beauftragt mit der Durchführung sind Abtprimas Jeremias Schröder OSB sowie Sr. Christine Rod MC, eine erfahrene Ordensfrau der Missionarinnen der Nächstenliebe und Generalsekretärin der Österreichischen Ordenskonferenz.
Im Fokus der Visitation steht insbesondere der Leitungsstil von Abt Maximilian Heim, ebenso wie der Umgang mit etwaigen Missständen innerhalb der Gemeinschaft. Zudem sollen Fragen der Auswahl, Ausbildung und Begleitung junger Mönche überprüft werden. Der Vatikan spricht in seinem Schreiben von einem „Zeichen wohlwollender Unterstützung“ und betont, dass es sich nicht um eine Strafmaßnahme, sondern um eine „hilfreiche Begleitung“ handelt.
Hintergrund der Visitation sind auch anonyme Schreiben, in denen teils schwerwiegende Anschuldigungen gegen einzelne Mitglieder des Konvents erhoben werden. Diese Briefe wurden sowohl an kirchliche Stellen als auch an Medien und Behörden weitergeleitet. Die Abtei sieht sich dadurch gezwungen, rechtliche Schritte einzuleiten. So erklärte Prior Johannes Paul Chavanne gegenüber dem ORF: „Es gibt anonyme Briefe, die völlig unglaubwürdige Vorwürfe gegen ein Mitglied unserer Gemeinschaft erheben. Wir haben Anzeige wegen übler Nachrede und Verleumdung erstattet.“
Bislang wurden keine konkreten oder bestätigten Vorwürfe öffentlich gemacht. Dennoch nimmt das Stift die Visitation sehr ernst – und offen. In einer Stellungnahme heißt es, man sehe darin eine Chance zur Reflexion und Weiterentwicklung. Besonders betont wird, dass Heiligenkreuz bereit sei, offen mit Fragen der Führung, Verantwortung und geistlichen Kultur umzugehen.
Die Visitation soll im Herbst 2025 beginnen. Nach Abschluss wird ein ausführlicher Bericht an das zuständige Dikasterium übermittelt. Daraus könnten Empfehlungen hervorgehen, die langfristige Veränderungen im Stift nach sich ziehen – etwa im Bereich der Leitungsstruktur, der Kommunikation oder der Ausbildung.
Heiligenkreuz ist mit über 1000-jähriger Geschichte eines der bedeutendsten Klöster im deutschsprachigen Raum. Die derzeitige Prüfung steht somit auch exemplarisch für die Herausforderungen, vor denen viele Ordensgemeinschaften heute stehen: der Balanceakt zwischen Tradition und Reform, zwischen geistlicher Tiefe und struktureller Klarhei
Religion als integrative Kraft
Japan geht neue Wege
Japan steht vor einem historischen Wandel: Angesichts dramatischer Überalterung und Arbeitskräftemangel öffnet sich das Land zunehmend für ausländische Fachkräfte. Allein 2024 lebten über 2,3 Millionen ausländische Arbeitskräfte im Land – Tendenz steigend. Die Regierung forciert neue Visa-Programme, modernisiert Ausbildungssysteme und spricht inzwischen offen von „dauerhafter Einwanderung“. Doch ein Aspekt der Integration bleibt vielfach unbeachtet: die Rolle der Religion.
Einwanderung – ja, Integration?
Während neue Visa-Kategorien wie das „Specified Skilled Worker“-Programm ausländischen Arbeitskräften erstmals dauerhafte Perspektiven eröffnen, hinkt die gesellschaftliche Integration oft hinterher. Sprachbarrieren, kulturelle Missverständnisse und institutionelle Unsicherheit prägen vielerorts den Alltag. Gerade religiöse Bedürfnisse – von Gebetsräumen bis zu Feiertagen – stoßen häufig auf Unkenntnis oder Ignoranz.
„Viele Arbeitgeber wissen schlicht nicht, wie wichtig Religion für vietnamesische Christen, philippinische Katholiken oder muslimische Arbeiter aus Indonesien ist“, sagt Sr. Noriko Tanaka, Sozialarbeiterin in Yokohama. „Dabei ist der Glaube oft das Einzige, was sie mit ihrer Heimat verbindet.“
Kirche als Zuflucht
Besonders in Regionen mit hohen Migrantenanteilen wächst die Bedeutung religiöser Gemeinschaften. In Aichi, einem Zentrum der japanischen Automobilindustrie, feiern katholische Gemeinden mittlerweile Gottesdienste in bis zu acht Sprachen – darunter Vietnamesisch, Tagalog und Portugiesisch.
Ein Priester in Nagoya, selbst vietnamesischer Herkunft, beschreibt seine Mission so: „Ich sehe, wie erschöpft, einsam und kulturell entwurzelt viele unserer Gemeindemitglieder sind. Wenn sie hier gemeinsam beten, ist das mehr als Religion – es ist Trost, Familie, Identität.“
Die katholische Kirche ist damit nicht nur seelsorgerlich aktiv, sondern leistet konkrete Integrationshilfe: beim Ausfüllen von Anträgen, beim Dolmetschen, bei rechtlichen Problemen oder einfach im Alltag. In manchen Regionen fungiert sie fast wie eine Parallelstruktur zur staatlichen Integrationspolitik – allerdings meist ohne öffentliche Förderung.
Japan und die Religion der Anderen
Trotz verfassungsmäßig garantierter Religionsfreiheit und einem hohen Maß an gesellschaftlicher Toleranz bleibt Religion im öffentlichen Raum Japans eher unsichtbar. Nur rund zwei Prozent der Bevölkerung sind Christen, viele Japaner:innen haben kaum konkrete Berührung mit gelebter Religiosität – etwa mit dem fünfmaligen Gebet im Islam oder dem Wunsch nach Fasten in der christlichen Fastenzeit.
Eine Studie des Japan Center for International Exchange (JCIE) zeigt: Die häufigsten Konflikte am Arbeitsplatz entstehen nicht durch Ablehnung, sondern durch Unwissen. Ein Beispiel: Vietnamesische Arbeitskräfte fasten oft vor wichtigen Feiertagen – was von Kollegen als „Arbeitsverweigerung“ missverstanden wird.
Der Staat zieht nach – langsam
Erst seit Kurzem reagiert auch die Regierung. Neue Handbücher für Unternehmen empfehlen, auf religiöse Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen – etwa durch Bereitstellung von Rückzugsräumen oder flexible Essensangebote. In Kawasaki und Hamamatsu wurden erste kommunale „Religionsguides“ für Arbeitgeber veröffentlicht. Pilotprojekte testen interkulturelle Schulungen mit Fokus auf religiöse Sensibilität.
Doch vieles bleibt Stückwerk. Experten fordern eine umfassendere Sichtweise: Religion dürfe nicht als „Privatsache“ abgetan werden, sondern müsse als Ressource für psychische Gesundheit, soziale Stabilität und kulturelle Integration ernst genommen werden.
KI: Bruder David Chat-Bot
Seit Kurzem ist der „Bruder David Bot“ online – eine Dialog-App, die es ermöglicht, mit dem spirituellen Werk des 98-jährigen Benediktinermönchs David Steindl-Rast digital in Kontakt zu treten. Der Chatbot basiert auf Steindl-Rasts umfangreichem Nachlass und soll als seelsorglicher Beitrag den konstruktiven Umgang mit Künstlicher Intelligenz fördern. Entwickelt von Informatikprofessor Wolfgang Pree, steht die App auf Deutsch, Englisch und Spanisch zur Verfügung und thematisiert vor allem Dankbarkeit, Achtsamkeit und interreligiösen Dialog.
„Möge ich noch viele Jahre dienen“
Der Dalai Lama feiert seinen 90. Geburtstag
Mit Gesängen, Gebeten und Tausenden Anhängern hat der 14. Dalai Lama, Tenzin Gyatso, im nordindischen Exil seinen 90. Geburtstag gefeiert. Die Feierlichkeiten fanden im Kloster Tsuglakhang in Dharamshala statt – dem spirituellen Zentrum der tibetischen Exilgemeinschaft. Für viele Gläubige weltweit markiert dieser Tag nicht nur ein persönliches Jubiläum, sondern auch einen Wendepunkt für den tibetischen Buddhismus.
Ein Leben für den Frieden
Geboren am 6. Juli 1935 in Taktser, einer kleinen Ortschaft in Osttibet, wurde Tenzin Gyatso bereits im Alter von zwei Jahren als Reinkarnation des 13. Dalai Lama identifiziert. 1950 übernahm er – erst 15-jährig – offiziell die politische Führung Tibets. Nach dem gescheiterten Volksaufstand gegen die chinesische Besetzung floh er 1959 nach Indien, wo er bis heute im Exil lebt.
In den folgenden Jahrzehnten wurde er zu einer globalen Symbolfigur für Gewaltlosigkeit und religiöse Toleranz. 1989 erhielt er den Friedensnobelpreis. Trotz politischer Isolation durch China ist sein Ansehen international ungebrochen.
Feierliche Worte – und ein Versprechen
Zum 90. Geburtstag wurden dem Dalai Lama Long-Life-Prayer-Zeremonien gewidmet – traditionelle tibetisch-buddhistische Rituale zur Lebensverlängerung. In einer öffentlichen Ansprache sagte er: „Mit dem Segen von Avalokiteshvara hoffe ich, noch 20, vielleicht 30 Jahre weiterleben und den Lebewesen dienen zu können.“
Die tibetische Exilregierung wertete dies als „ermutigendes Zeichen“ für Stabilität und spirituelle Führung in einer Zeit wachsender Unsicherheit.
Streit um die Nachfolge
Trotz der feierlichen Stimmung überschattete ein Thema die Jubiläumsfeierlichkeiten: die Nachfolge des Dalai Lama. Bereits seit Jahren versucht die chinesische Regierung, Einfluss auf die Auswahl des nächsten spirituellen Oberhaupts zu nehmen. Peking beansprucht das alleinige Recht, die Reinkarnation des Dalai Lama festzustellen – ein Vorgehen, das von Tibetern als unrechtmäßige Einmischung abgelehnt wird.
Tenzin Gyatso selbst hatte sich im Vorfeld des Geburtstags klar positioniert: „Die Entscheidung über meine Reinkarnation liegt allein bei mir und meiner Institution, dem Gaden Phodrang Trust. Kein politisches System – und keine Regierung – kann das bestimmen.“
Er deutete an, dass seine Nachfolge außerhalb von Tibet – möglicherweise in einem freien Land – gefunden werden könne. Zudem schloss er nicht aus, dass sein Nachfolger eine Frau sein könnte.
Die Zukunft des tibetischen Buddhismus
Der Dalai Lama hat die politische Führung der tibetischen Exilregierung bereits 2011 abgegeben. Dennoch bleibt seine spirituelle Autorität unbestritten – nicht nur unter Tibetern, sondern auch in buddhistischen Gemeinschaften weltweit.
Beobachter warnen allerdings vor einem möglichen „Nachfolge-Vakuum“. Sollte es zu konkurrierenden Anerkennungen durch Peking und das Exil kommen, drohe eine tiefe Spaltung innerhalb des tibetischen Buddhismus.
Interessante Videos und Podcasts
Brennpunkt Afrika
Nneka: Die kraftvolle Stimme Nigerias
Zwischen Musik, Politik und Spiritualität
Die nigerianisch-deutsche Sängerin Nneka Lucia Egbuna hat sich über zwei Jahrzehnte als eine der markantesten Künstlerinnen der internationalen Musikszene etabliert. Ihre Songs verbinden Soul, Hip-Hop, Afrobeat und Reggae mit politischen und spirituellen Botschaften. Ihre persönliche Geschichte zwischen Nigeria und Deutschland verleiht ihrer Musik Tiefe und Authentizität.
Frühe Jahre und musikalischer Aufbruch
Geboren am 24. Dezember 1980 in Warri, Nigeria, wuchs Nneka in schwierigen Verhältnissen auf. Später zog sie nach Deutschland, um Anthropologie zu studieren. Um ihr Studium zu finanzieren, trat sie in Hamburger Clubs auf. Mit ihrem Debütalbum Victim of Truth (2005) gelang ihr der internationale Durchbruch.
Nneka beschreibt ihre Musik als „eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Realität“: „Ich will nicht nur unterhalten, sondern mit meiner Musik auch Veränderungen anstoßen.“
Gesellschaftliches Engagement
Nneka ist bekannt für ihre Texte, die soziale Ungerechtigkeiten, Umweltzerstörung im Niger-Delta und persönliche Schicksale thematisieren. Ihr Einsatz geht über die Bühne hinaus: Sie gründete die Rope Foundation, die junge afrikanische Künstler fördert und Frauen unterstützt, die Gewalt erlebt haben.
Über ihren Antrieb sagt sie: „Musik ist für mich ein Werkzeug des Wandels. Sie kann Brücken bauen, wo Mauern stehen.“
Aktuelle Projekte und Ausblick
2025 fokussiert sich Nneka auf die Kombination von Musik und visueller Kunst. Ihr letztes Album My Fairy Tales (2015) war nur der Anfang. Aktuell arbeitet sie an einem neuen Projekt, das Musik, Film und Aktivismus verbindet, um globale Themen wie Migration und Umwelt aufzugreifen.
Nneka berichtet: „Ich möchte Geschichten erzählen, die oft übersehen werden – und dabei neue Formen der Kunst entdecken.“
Internationaler Erfolg und Zukunft
Mit Preisen wie dem MOBO Award für „Best African Act“ und Kollaborationen mit Künstlern wie Nas und Damian Marley hat Nneka sich weltweit einen Namen gemacht. Ihre Konzerte sind nicht nur musikalische Erlebnisse, sondern auch politische Statements.
Sie betont: „Solange es Ungerechtigkeit gibt, ist meine Arbeit noch nicht getan.“
Nneka bleibt eine Brückenbauerin zwischen Kontinenten und Kulturen, deren Musik Menschen berührt und zum Nachdenken anregt – heute mehr denn je.
Hier ein Auswahl ihrer Lieder:
Heartbeat
Ein soulvoller Afrobeat-Song, der von persönlicher und kollektiver Stärke handelt. Er ruft dazu auf, trotz Schmerz und Widrigkeiten die eigene Lebensenergie und Hoffnung nicht zu verlieren.
Soul Is Heavy
In diesem Lied verarbeitet Nneka die Last sozialer Ungerechtigkeit und persönlicher Kämpfe. Die düstere Stimmung unterstreicht die Herausforderungen, denen sich viele Menschen in Nigeria und weltweit gegenübersehen.
Shining Star
Ein positives, fast hymnisches Stück, das Mut macht und Selbstwertgefühl stärkt. Nneka feiert hier die Kraft der eigenen Identität und das Licht, das in jedem Menschen leuchtet.
Africans
Der Song thematisiert Kolonialismus, kulturelle Entwurzelung und den Kampf um Selbstbestimmung. Musikalisch verbindet er Reggae-Elemente mit Hip-Hop-Rhythmen und einem eindringlichen Chor.
Viva Africa
Ein kraftvoller Afrobeat-Track, der Stolz und Hoffnung für den afrikanischen Kontinent ausdrückt. Er spricht von Widerstand gegen Unterdrückung und dem Wunsch nach einer besseren Zukunft.
Wenn du diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, kannst du dich hier abmelden.