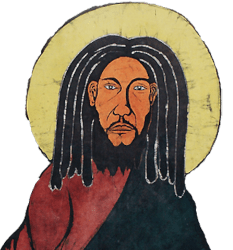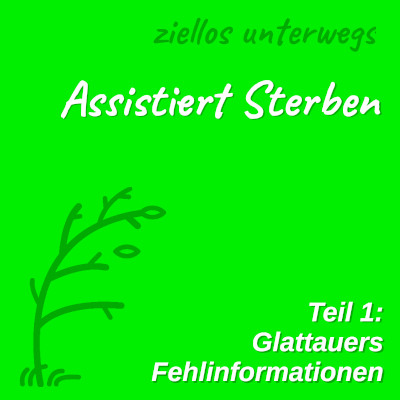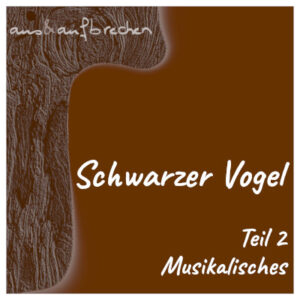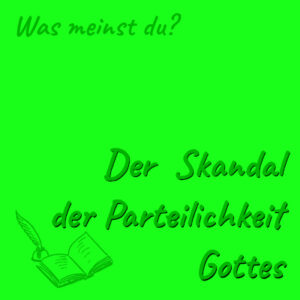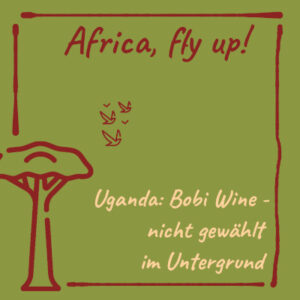Anfang September. Kühles Wetter, aber heiße Diskussion um ein Interview. Der Autor Niki Glattauer möchte sich das Leben nehmen. Was zu dieser Entscheidung geführt hat, schildert er den Journalisten Florian Klenk (Falter) und Christian Nusser (newsflix).
Klarerweise verteidigt er die Möglichkeit des assistierten Suizids. Aber hat er damit Recht?
Man könnte das Gesagte auf sich beruhen lassen. Mit dem Hinweis auf den Respekt, den man den Entscheidungen anderer zu erweisen habe, könnte argumentiert werden, dass Glattauer nicht widersprochen werden dürfte. Eine unsinnige Ansicht, denn wer sich öffentlich äußert, möchte am öffentlichen Diskurs teilnehmen und muss auch damit rechnen, dass ihm öffentlich widersprochen wird.
Wobei in diesem Fall das Interview einen besonderen Charakter bekommt: Hier gibt einer ein Statement ab und entzieht sich der weiteren Debatte durch seinen Tod. Damit bekommt dieses Statement den Nimbus eines doktrinären Zeugnisses, das durch seine praktische Ausführung glaubwürdig wird. Glattauer wird so zum Missionar des assistierten Suizids.
Eine Gegenrede ist zwar möglich; auf sie kann Glattauer aber nicht mehr reagieren. Zugleich hat Glattauer aber auch das Problem, dass er Interpretationen seines Zeugnisgebens nicht mehr widersprechen kann.
Die Gegenrede hat in einem solchen Fall zusätzlich ein existenzielles Moment: Würde nämlich die Kritik die Schwachstellen der Argumentation Glattauers aufweisen, müsste er sich vielleicht eingestehen, dass die Verwirklichung des Sterbewunsches auf falschen Voraussetzungen beruht. Nur: Nach dem Tod kann man weder am Diskurs teilnehmen, noch eigene argumentative Schwachstellen erkennen, noch vom Tod zurückkehren.
Wie dem auch sei: Ich möchte in diesem Beitrag in einigen Punkten Glattauer widersprechen. Dabei wird es um lebensphilosophische Ansichten gehen, aber auch um glatte Fehlinformationen, die er verbreitet, und die auch von den Interviewern nicht aufgeklärt werden.
Mir geht es jedoch weniger um argumentative Schwachstellen, sondern mehr um eine andere Perspektive.
Dabei möchte ich selbstverständlich beachten, dass nicht jedes Wort in einem spontan gesprochenen Interview auf die Goldwaage zu legen ist. Auf der anderen Seite hat er sicher schon einige solcher Gespräche geführt und sich seine Entscheidung gut überlegt.
Nicht um jeden Preis leben!
Beginnen möchte ich mit einer Übereinstimmung. Glattauer sagt, er möchte nicht um jeden Preis leben. In der heutigen Medizin – so meine ich – wird der Tod derart verdrängt, dass so lange medizinische Eingriffe vorgenommen werden, so lange noch solche vorgenommen werden können.
Glattauer selbst hätte noch einige durchführen müssen, hätte er weiterleben wollen. Dem gegenüber kann man die Frage stellen: Muss man alles tun, was man tun kann? Ist es nicht auch einmal gut? Auch mit dem eigenen Leben?
Glattauer stellt dieses Leben in einen größeren Horizont: Es sei nur eine kleine Episode im Ganzen. Er geht davon aus, dass es nach dem Tod noch etwas gibt, obwohl wir kein Bewusstsein mehr haben werden. Und er deutet an, dass er denkt, dass man ja auch vor der Geburt tot war.
Im Ganzen ist dieses Leben nur ein kleiner Sidestep im Totsein – um es mit meinen Worten zu sagen.
Der Frage, wann es mit dem Leben auch mal gut ist, stellen wir uns gewöhnlich selten bis gar nicht. Und die Ärzt:innenschaft ist ja nicht dazu da, den Patient:innen zu sagen: „Wir könnten noch was tun, aber ehrlich gesagt: Ich würde es gut sein lassen.“
Kann ein Leben am Ende noch weiter gehen?
Die interessantere Frage, die ich mir seit einigen Jahren stelle: Kann ein Leben zu Ende sein, auch wenn es weiter geht? Was sich für viele düster anhört, kann auch als Befreiung erlebt werden.
Glattauer stellt diese Frage nicht explizit. Er sagt aber: „Ich habe eh alles erreicht.“ Ein bisschen klingt das nach dem Abarbeiten einer To-Do-Liste. Alle Häkchen sind gesetzt. Die Arbeit, und damit das Leben, ist erledigt. Jetzt kann ich gehen.
Sicherlich ist das etwas überspitzt von mir formuliert, und sicherlich ist das nicht der Grund für Glattauers Entscheidung. Aber gerade Männer in der Mitte ihres Lebens stellen sich ja oft die Frage, was noch kommen soll, nachdem sie scheinbar alles erledigt haben.
Kann also das Leben weiter gehen, wenn es schon zu Ende ist? Aufgabenlos? Befreit von dem, dass man noch etwas zu erreichen hat?
Aber ich meine diese Frage noch in einem anderen Sinn: Man kann das Ende des Lebens auch als Ende von Abhängigkeiten begreifen: Zwar bin ich noch abhängig von anderen, aber andere nicht mehr von mir. In Anbetracht des Endes des Lebens in diesem Sinn: Kann ich dann nicht getrost bereit sein, jederzeit zu sterben? Ist es nicht auch eine Art von Befreiung, wenn ich jederzeit aus dem Leben scheiden kann? Die Welt dreht sich weiter. Auch ohne mich. Weil von mir nichts mehr abhängt?
Die Romantisierung des Todes?
Ich bin mit meinen Gedanken schon weit über das hinausgegangen, was Glattauer selbst thematisiert hat. Aber der Diskurs soll uns ja anregen, weiter zu denken.
Man könnte mir jetzt vorwerfen, ich romantisiere das Sterben und den Tod. Das will ich nicht, denn es gibt ganz grausliche Arten zu sterben. Glattauer weist darauf hin. Er hat damit Recht. Und genau das ist die eigentliche Begründung für seine Entscheidung.
„So will ich nicht sterben“, sagt er in Hinblick auf seinen von Krebs und anderen Krankheiten desolaten Körper. Ja, das ist gut nachvollziehbar. Auch ich kann mir viele Sterbeprozesse vorstellen, die ich lieber nicht am eigenen Leib erleben möchte.
Dass aber solche Sterbeprozesse als entwürdigend dargestellt werden und einzig der assistierte Suizid ein würdevolles Sterben ermöglicht, ist aus meiner Sicht schlichtweg überheblich. Problematisch genug, dass die Interviewer diese Ansicht auch teilen. Wie anders könnte es sonst sein, dass sie nicht kritisch nachfragen.
Wir verdrängen ja nicht nur unseren eigenen Tod, sondern auch das Leiden. Und zwar auf vielen Ebenen: Wir lassen Menschen qualvoll verhungern, im Mittelmeer ertrinken und im Krieg niedermetzeln. Und so wollen wir auch das Leiden an uns selbst wegschieben. Ein leidvolles Sterben ist kein würdevolles Sterben mehr.
Und damit ist die Diskussion schon beendet. Schließlich wollen wir von niemandem fordern, Leid auf sich zu nehmen. Das kann Jesus machen. Aber der interessiert eh niemanden mehr.
Dennoch: Ist es so unglaublich, dass das Ertragen von Leiden auch in Würde geschehen kann? Verliert ein Mensch seine Würde, wenn er, von Schmerzmitteln ins Halbbewusstsein befördert, im Bett liegt und tage- und wochenlang auf seinen Tod wartet?
Die Grundfrage ist doch: Kann ein Mensch, abhängig von seinem Lebens- und Sterbeprozess, seine Würde verlieren?
Gut, man kann mir vorwerfen, dass ich von der Würde des Menschen, Glattauer aber von der Würde des Sterbens spricht. Mein Punkt ist aber vielmehr: Hier wird mit einem Begriff hantiert, der völlig unbestimmt ist. Damit wird eine Situation romantisch und moralisch aufgeladen, hinter der etwas ganz anderes steckt.
Nämlich Angst: Ich gebe zu: Ich habe Angst davor, qualvoll zu sterben. Und das möchte ich Glattauer und jedem anderen auch zugestehen. Aber bitte, machen wir aus dem assistierten Suizid keine ethische Heldentat, wenn wir ihn als würdevolles Sterben bezeichnen. Er ist nicht mehr als die Flucht vor einer Angst. Und, ganz unabhängig von der ethischen Bewertung dieser Flucht, kann ich das sehr gut nachvollziehen.
Leider romantisiert Glattauer durchweg seinen gewählten Sterbeprozess. Nämlich gerade da, wo er darstellt, wie er die letzten Tage verbringen will. Das alles sei ihm unbenommen, und ich würde das vielleicht genauso machen. Diese Romantisierung hat aber auch problematische Folgen. Diese sind verbunden mit Fehlinformationen, die Glattauer in seinem Interview gibt.
Die Fehlinformationen Glattauers
Glattauer hätte bei seinem Suizid nicht nur seine Familie um sich, sondern auch eine Ärztin. Er meint, dass gar nicht so einfach sei, einen Termin zu finden, da man ja von der Ärztin abhängig wäre.
Damit insinuiert er, dass bei jedem assistierten Suizid eine Ärztin dabei sei. Das kann jedoch nur machen, wer die finanziellen Mittel dazu hat. Das Sterbeverfügungsgesetz sieht das jedoch nicht vor. Dem Gesetz ist es nämlich egal, wer beim Sterben dabei ist und wo das Sterben stattfindet. Man kann allein sterben oder umringt von Freunden und Verwandten. Man kann zu Hause, im Wald oder in aller Öffentlichkeit sterben.
Niemand schreibt einem einen Termin vor, und von Ärzt:innen ist man schon gar nicht abhängig.
Und wenn man Pech hat, dann geschieht bei der Mischung des Tötungsmittels ein Missgeschick und man weiß nicht, ob es überhaupt noch eine tödliche Dosis enthält.
Es kann also alles andere als romantisch sein.
Eine zweite Falschinformation ist, dass Glattauer meint, dass auch lebensmüde Menschen eine Sterbeverfügung errichten können. Ich glaube, er denkt dabei an depressive oder anders psychisch erkrankte Menschen.
Zugegeben: Das Sterbeverfügungsgesetz enthält eine Formulierung, die dies zuzulassen scheint. Allerdings ist für die Errichtung einer Sterbeverfügung die Entscheidungsfähigkeit vonnöten. Daher muss bei einer psychischen Erkrankung auch ein Psychiater hinzugezogen werden. Und man kann zweifeln, ob ein psychisch kranker Mensch juristisch als entscheidungsfähig gilt.
Nach reiflicher Überlegung?
Glattauer macht überhaupt den Eindruck, dass er sich alles reiflich überlegt habe. Er hat Argumente abgewogen, eine Pro-Contra-Liste gemacht und dann eine Entscheidung getroffen.
Kann man diesem Eindruck wirklich trauen? Nein. Denn er selbst gibt zu, dass er auch oft weint. Im Interview gibt er den souveränen Entscheider. Tatsächlich kann man fragen, wie viel Verzweiflung und Angst hinter dieser Entscheidung stecken.
Er vermittelt das Bild, als ob eine solche Entscheidung rein rational gefällt werden könnte. Und das ist neben der Romantisierung ein weiteres Problem in der öffentlichen Darstellung.
Die Mission: Aufruf zur Nachahmung?
Aus der Suizidforschung wissen wir, dass Romantisierung und Idealisierung von Suiziden zur Nachahmung führen. Dies wird Werther-Effekt genannt.
Der Journalist und Interviewer Florian Klenk meinte in einem anderen Kontext, dass es keine wissenschaftliche Studie gäbe, die nachweise, dass solche Interviews über assistierten Suizid zu mehr solchen Suiziden führen würden. Klenk scheint zwischen assistierten Suiziden und anderen, „normalen“, Suiziden zu unterscheiden.
Mag sein, dass es keine solchen Studien gibt. Das Fatale ist nur, dass Glattauer eine Mission zu haben scheint: Aufklärung über den assistierten Suizid. Eine der ersten Aussagen Glattauers auf die Frage, warum er das Interview gibt, ist, dass er die Menschen darauf aufmerksam machen möchte, dass man sich in Österreich assistiert Suizidieren kann.
Natürlich ist das keine Verführung zum Suizid. Aber der Same positiver Darstellung wurde ausgesät und wächst in den Menschen und ist dazu ausgelegt, dass sich mehr Menschen für diese Todesart entscheiden. Ohne zu berücksichtigen, dass die Romantisierung Glattauers nicht der Realität entspricht und würdevolles Sterben nicht gleichbedeutend ist mit leidlosem Sterben.
Der Schein einer emotionsfreien, rationalen Entscheidung, gepaart mit Romantisierung und Idealisierung, entwickelt selbstverständlich eine Sogwirkung.
Insgesamt wird also der Eindruck vermittelt, der assistierte Suizid sei eine selbstbestimmte Entscheidung. Darüber habe ich in diesem Beitrag noch gar nicht gesprochen: Über die Selbstbestimmung. Denn Selbstbestimmung ist für Glattauer das wichtigste Moment in seiner Argumentation.
Im zweiten Teil meines Beitrages (in einer Woche) werde ich dieses Thema ausführlich behandeln und zeigen, dass es mit der Selbstbestimmung auch nicht weit her ist. Der Selbstbestimmung wird in unserer Gesellschaft ein viel zu hoher Stellenwert beigemessen, den sie real gar nicht hat. Man fantasiert eine Realität, die es nicht gibt.